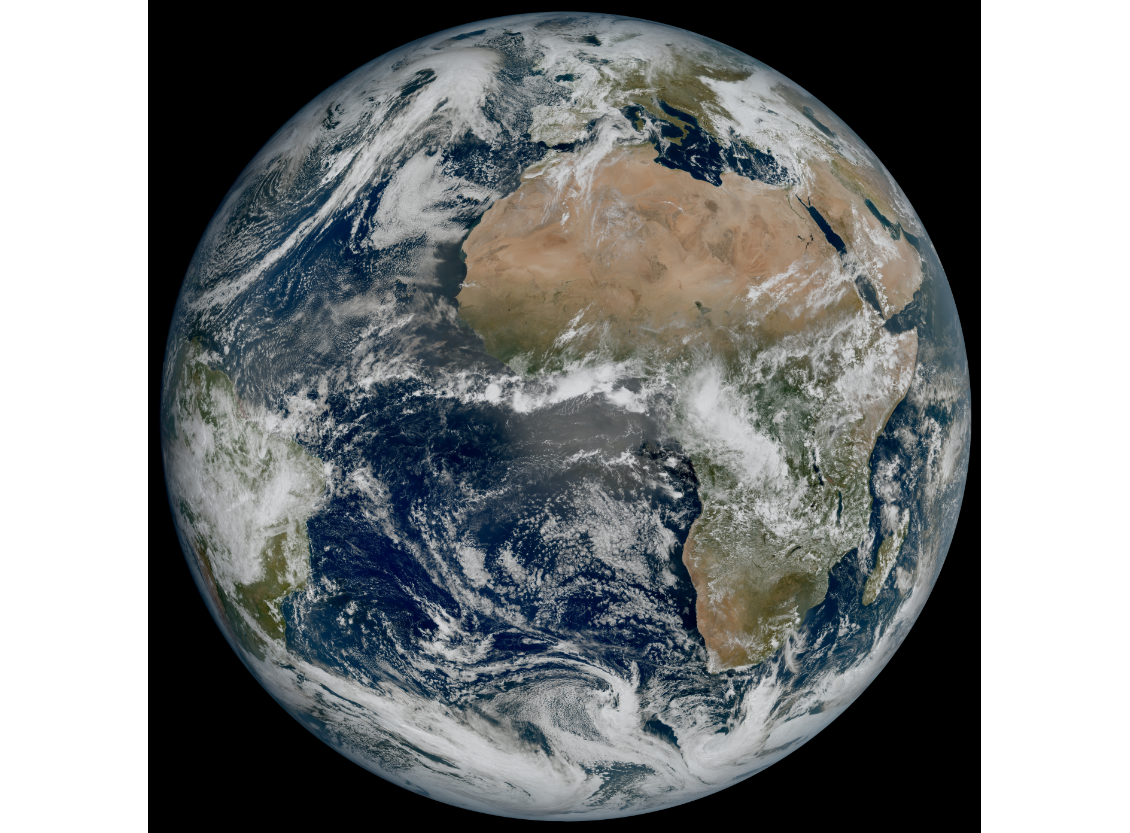Warum musste Jesus sterben?

Sühnopfer und Evolution
von Simone Brietzke
1. Was ist für mich „das Böse“?
Was ist für mich „das Böse“, oder „Sünde“? Ich fasse „das Böse“ und „Sünde“ ziemlich weit, nicht nur auf Zwischenmenschliches bezogen. Für mich ist es alles, was damit zu tun hat, jemandem oder etwas Anderem zu schaden, gar zu töten, physisch oder emotional zu verletzen, oder seinen Lebensraum zu zerstören. Im Zwischenmenschlichen kommen für mich noch Unterlassungssünden hinzu. Und in Bezug auf Gott auch, ihn nicht genügend in den Lebensmittelpunkt zu stellen, eine gestörte Beziehung zu ihm zu haben, das Ziel des Lebens zu verfehlen (griech. sündigen = harmatanein, wörtlich wohl: den Punkt verfehlen, das Ziel nicht treffen). Einfacher ausgedrückt: sich absondern vom Anderen, vom Fluss des Lebens, vom Lebensnetz.
Alles Erstgenannte gibt es spätestens seit der Entstehung des Lebens, in übertragenem Sinne auch schon seit „dem Urknall“. Es ist nicht möglich zu existieren, ohne anderem Leben, anderen Existenzen, zu schaden und zu töten, um sich zu ernähren. Leben beruht auf der Vernichtung von anderem Leben. Energie auf der Vernichtung anderer Energie. In der Biologie gibt es viele gute Gründe für Aggression im Dienste des Überlebens. Vieles davon wird unter dem Stichwort „Egoismus der Gene“ zusammengefasst. Auf ganz harte Weise geht es darum, seinen oder nahe verwandten Genen das Überleben in der nächsten Generation zu sichern. Dadurch findet auch die Selektion zu den „am besten Angepassten“ (Darwin: survival of the fittest) statt. Gewalt, Konkurrenz und Durchsetzungsvermögen ist die eine Hälfte dessen, was Fortentwicklung und Leben möglich macht.
2. Was ist für mich „das Gute“?
Die andere Hälfte der Evolution ist Kooperation, sich zusammenschließen, Gemeinschaften bilden, sich im Nächsten sehen und sich mit ihm verbinden. Das gibt es auch schon seit dem Urknall: Energien ballen sich zu subatomaren Teilchen, diese zu Atomen, diese zu Gasen, diese bilden Sterne, aus Sternenstaub entstehen neue Sterne mit neuen Elementen, die aus mehr Atomen bestehen. Aus den Atomen werden Moleküle, diese beginnen zu kooperieren und bilden Bakterien, mehrere Bakterien bilden echte Einzeller, diese schließen sich zu Mehrzellern zusammen. In den Mehrzellern entstehen Arbeitsteilungen und Kooperationen. Organe bilden sich in komplexen Vielzeller. Diese Vielzeller fangen wieder an, untereinander arbeitsteilig und kooperativ zu werden – schon bei Pflanzen, aber erst recht bei staatenbildenden Tieren wie Bienen und Ameisen, und natürlich beim Menschen.
Und für mein Verständnis spricht Johannes davon im Anfang seines Evangeliums, wenn er sagt, dass Christus – als das Prinzip dieser „Liebe“ und Kooperation – seit Anbeginn der Welt da ist und alles aus ihm erschaffen ist! Und dieses aufbauende Prinzip muss auf lange Sicht immer ein wenig stärker sein als das zerstörerische, tödliche Prinzip – das genauso nötig ist, sonst bliebe alles beim Alten. Beide Prinzipien sind für die Weiterentwicklung und den Erhalt des Lebens nötig, und daher von Gott gewollt. Ohne eines von beiden geht es nicht.
3. „Prinzipien“
Dieses Denken gibt es schon seit Plato, dass nämlich hinter den real vorkommenden Dingen und Ereignissen abstrakte Prinzipien (Ideen) stehen, welche die materielle Welt erst ermöglichen. Ich denke, da ist etwas Wahres dran. Jedenfalls gehen alle, auch das „böse“ Prinzip aus dem hervor, was wir „Gott“ nennen. Gott ist nicht nur „lieb“. Er umfasst die ganze Wirklichkeit.
Und ich denke, es ist möglich, sich auf geistigem Wege mit beiden Prinzipien zu verbinden und sich von ihnen verändern zu lassen, in ihnen zu wachsen – auch im „Bösen“. Man kann mit Sicherheit auch in die „böse“ Hälfte des Lebens stärker hineingezogen werden, als es nötig und gottgewollt ist. Für den Entwicklungsprozess muss diese Freiheit gegeben sein. Aber sie kann eine Eigendynamik entwickeln.
4. Das Theodizee-Problem
Hier löst sich auch ziemlich zwanglos das Theodizee-Problem: „Warum lässt Gott das zu?“ Die Fortentwicklung des Lebens konnte nur bei sich ändernden Umweltbedingungen stattfinden, die neue Anforderungen stellten, so dass neue Antworten gefunden werden mussten. Naturkatastrophen muss es geben, damit neue Nischen entstehen, in denen sich Leben weiterentwickeln kann. Tod muss es geben, damit die nächste, etwas weiterentwickelte Generation Raum hat. Der Mensch ist nicht für das ewige Leben geschaffen, es ist notwendig, dass wir sterben.
Gene müssen durch Umweltfaktoren oder durch Mutationen verändert werden können, damit Fortentwicklung möglich ist. Aber Veränderungen an Genen lösen oft Krankheiten aus. Die Entwicklung braucht Zufälligkeiten und die Freiheit, jede, auch (erst einmal) schädliche und „böse“ Möglichkeiten auszutesten. All dies hört nicht an der Stelle auf, wo es uns weh tut, wo zum Beispiel Verwandte jung sterben. Das Leben muss sein, wie es ist, auch wenn wir persönlich getroffen werden. Gott muss es zulassen, in unser aller langfristigem Interesse. Anscheinend bis zum Holocaust.
5. Fortgang der Evolution
Meine Hoffnung ist, dass die Notwendigkeit für die „böse“ Hälfte mit dem Lauf der Entwicklung nachlässt, dass die Christushälfte langsam immer stärker werden kann und wir die andere Hälfte, die überwiegend zu unserem physikalischen und biologischen Erbe zählt, nach und nach mehr hinter uns lassen können; dass Gewaltlosigkeit, Kooperation und der geistige Anteil am Leben zunehmen werden; dass wir weniger „sündigen“ müssen; dass vielleicht etwas dran ist, was aus verschiedenen Kulturen berichtet wird, dass es möglich ist, jahrelang nur von Hostien bzw. Lichtnahrung zu leben. Ich denke, diese Hälfte ist ein Weg zum Reich Gottes, und Gott hilft uns dabei, dorthin zu gelangen – nur in seinen Zeitspannen und nicht in unseren. Aber das Reich Gottes ist schon mitten unter uns …
6. Sündigen
Es ist uns einfach nicht gegeben auf dieser Welt, ohne Sünde zu leben. Fast keine Sekunde lang, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst sind. Wir könnten in jedem Augenblick etwas anders und besser machen, mehr lieben, mehr kooperieren, weniger an uns denken, andere Produkte kaufen, uns ökologischer verhalten … Aber wir sind genau so geschaffen und genau so muss es sein. Wenn wir also von Anfang an genau so geschaffen sind und es genau so richtig ist, wie sollte unser Schöpfer uns dafür grundsätzlich verurteilen? Es ist schon frustrierend genug, als Sünder leben zu müssen, aber dafür auch noch grundsätzlich verurteilt werden? Das wäre zu grausam, ungerecht und zum Verzweifeln!
7. Sündenfall
Ich glaube nicht, dass es faktisch einmal so etwas wie das Paradies gab, in dem die Menschen tatsächlich ohne diesen weit gefassten Sündenbegriff leben konnten. Oder dass unsere Vorfahren jemals ohne diese wie auch immer zu verstehende Beziehungsstörung zu Gott gelebt haben. Es sei denn, damit ist ein Leben aus den Instinkten gemeint. Oder die Lebensweise von Kleinkindern. Ich denke, der „Sündenfall“ wird an dem Punkt erreicht, wo wir ein Bewusstsein für unsere Taten erhalten, wo wir reflektieren, was wir tun. Wir erkennen, was eigentlich Gut und Böse ist, ob wir uns an höhere Regeln als unsere Instinkte gehalten haben oder nicht. In gewissem Maße haben dies auch schon Tiere – ein schlechtes Gewissen kann man bei entsprechendem Verhalten mindestens bei Hunden, Pferden und Menschenaffen erkennen …
8. Todesstrafe für unsere Sünden
Die Genesis wird teilweise so gelesen, als ob „der Tod der Sünde Sold“ (Paulus) wäre. Aber Tod gibt es auch seit dem Urknall – Sterne mussten sterben, damit neue Elemente entstehen konnten. Und Leben hat es nie ohne Tod gegeben. Interessanterweise heißt es in Genesis 3 aber auch, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden, damit wir nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und unsterblich werden. (Vers 22-24: „Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.) Der Tod gehört also auch biblisch schon immer zum Leben.
9. Sühnopfertod
Die Sache mit dem Sühnopfertod ist eine uralte, eigentlich heidnische Geschichte. Nur Blut konnte Schuld auslöschen. Auch stellvertretend, etwa von Tieren, vergossenes Blut. Etliche Propheten haben sich schon gegen den Opferkult gewehrt („dass Gott Barmherzigkeit will, und keine Opfer“). Auch ist schon im AT und auch bei Jesus ständig davon die Rede, dass Gott Schuld vergibt aus Gnade, ohne dass jemand dafür sterben muss. Er kann sich aus eigener Macht mit uns versöhnen. Irgendwo stand, dass selbst das alte Judentum nicht glaubte, dass durch Blutopfer wirklich Schuld ausgelöscht würde – es sei mehr eine symbolische Handlung. Schuld wurde z.B. auch dadurch weggetragen, dass der Sündenbock (lebend!) in die Wüste geschickt wurde. Aber irgendwie kam die Botschaft nur teilweise an. Das jüdische Gesetz hat über 600 Gebote – 350 Verbote und 250 Gebote. Und die Schriftgelehrten unterteilten sie aus Angst noch immer weiter, weil es hieß, dass der Messias erst kommen wird, wenn sie ein oder zwei Sabbate lang alle Gebote eingehalten hätten. Der Druck, keinen Fehler zu begehen, der eventuell mit großen Strafen verbunden wäre, war ungeheuer.
Es heißt, dass nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem im Jahr 70 n.Chr. viele der bisherigen Opferpriester den Urgemeinden beitraten, und diese behielten den Glauben an das Blutopfer bei. Die Juden haben diese Vorstellung lang überwunden, wir noch nicht! Übrigens ist der Glaube an ein Leben nach dem Tod und ein Jüngstes Gericht eine recht neue Entwicklung im Judentum, die sie in der babylonischen Gefangenschaft von den Zarathustra-Religionen übernahmen. Vorher gab es keinen Himmel und keine Hölle, nur das Totenreich, scheol, in den alle gleichermaßen eingingen. Strafe und Lohn gab es nur im diesseitigen Leben.
Bei den Evangelisten spielt der Sühnopfertod – wenn er als Idee überhaupt tatsächlich so gemeint war – nur eine sehr untergeordnete Rolle. Jesu Lehre, Taten und Auferstehung waren viel bedeutender für die Entstehung des Glaubens.
10. Warum musste Jesus sterben?
In Jerusalem brodelte die Stimmung. Immer mehr Menschen wollten sich gegen die verhasste römische Besatzung wehren und setzten Hoffnungen auf einen Messias, der sie politisch befreien würde. Manche wollten, wie die Zeloten, nicht mehr warten und gleich aktiv werden. Gegen Rebellion gingen die Römer hart vor – die Standardstrafe war die Kreuzigung. In dieser Situation konnte die Ankunft von Jesus leicht der zündende Funke werden. Der Hohe Rat hatte an der Lehre von Jesus schon genug auszusetzen, aber er sah die Gefahr, dass es zu einem großen blutigen Aufstand käme. So wollten sie Jesus opfern. Der Hohepriester Kaiphas sagte: „Es ist besser, dass einer stürbe als viele.“ Es ist also vor allem die klassische Sündenbockgeschichte – einer muss sterben, damit wieder Ruhe ist. So gab Jesus tatsächlich sein Blut und seinen Leib „für uns“ – damit waren zuerst seine Jünger und Anhänger gemeint. Nur hatte das nichts mit Sünden zu tun. Wäre Jesus um ca. 30 n.Chr. nicht den Römern überantwortet worden, so wären die gewaltsamen Ereignisse von 66-70 n.Chr., die zur Zerstörung des Tempels führten, vielleicht 35 Jahre früher eingetreten;
so wäre Jesus dem Weg, den Gott ihm nach seiner Überzeugung vorgezeichnet hatte, nämlich mit aller Konsequenz für seine Erkenntnis der bedingungslosen Liebe einzustehen, untreu geworden …
11. Paulus
Paulus war ein eifernder Pharisäer; auf ihm lastete der Druck seiner Sündigkeit besonders stark. Er suchte nach einer Befreiung von der Last des Gesetzes und der Schuld. Interessant ist, wie man in der Bibel in den Paulusbriefen (Galater) nachlesen kann, dass Paulus mit den Jüngern Jesu gar nichts zu tun hatte – er ist nach seiner Jesusbegegnung, über die er sich im Detail (anders als in der Apostelgeschichte von Lukas) völlig ausschweigt, nach Damaskus gegangen zur dortigen Gemeinde und hat nur ihre Traditionen kennengelernt. Erst nach drei Jahren hatte er den ersten ziemlich kurzen Kontakt mit zwei Jüngern, und dann erst wieder nach 14 Jahren, nach seiner ersten Missionstätigkeit, um sich seine Lehre absegnen zu lassen bzw. um die Frage der Beschneidung der Heiden zu klären. Leben und Taten Jesu interessierten Paulus nicht, nur sein Kreuz und Tod und die durch ihn gewirkte Gnade, die Befreiung vom Gesetz. Ein Autor namens Burkhard Müller legt sogar detailliert dar, dass auch Paulus nicht allzu stark an eine Sühnopfertheologie glaubte, sondern eher an die durch Jesus vermittelte Gnade und an unser neues Leben durch die Wandlung durch den Glauben an Jesus.
12. Anselm von Canterbury und Luther
Die Sühnopfertheologie im heutigen Sinne wurde erstaunlicherweise erst im 11. Jahrhundert von Anselm von Canterbury festgeschrieben. Obwohl man nun eigentlich hätte glauben könnte, dass mit Jesus Tod unsere Schuld endgültig ausgelöscht sei, schürte die Kirche weiter die Angst vor der Sünde und der Verdammnis. Luther wehrte sich gegen den Ablasshandel und den Glauben an die Seligmachung durch gute Werke. Er verwies auf die Gnade der Vergebung, allein gewirkt durch den stellvertretenden Tod Jesu. Vor wenigen Jahren wurde dieses „allein aus Gnade“ auch von der katholischen Kirche anerkannt. Aber die Gnade ist noch viel umfassender, sie ist uns laut Jesus mit unserer Geburt ohne Vorbedingung gegeben!
13. Sünden, Gerechtigkeit und gute Taten
Für mich ist jesuanisch, dass Gott uns als seine Kinder schon immer angenommen hat, obwohl wir Sünder waren und sind. (vgl. den Bund mit Noah: Ich will die Welt nicht mehr zerstören, denn die Menschen sind (nun mal) böse von Jugend an. „So isses halt“.) Dazu ist nur nötig, dass wir unsere Schuld erkennen, das Problem erkennen und Gott bitten, uns zu vergeben und uns zu verwandeln. Wir werden dabei täglich und stündlich wieder auf die Nase fallen, aber wir brauchen darüber nicht zu verzweifeln, denn wir können nun mal nicht anders. Und Gott liebt uns trotzdem. Unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, auf dem Weg der Transformation zu bleiben, so gut wir können. Das ist kein Freibrief, sich hemmungslos daneben zu benehmen, sondern unser Ansporn ist die Mitarbeit am Reich Gottes, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir einen winzigen Schritt weiter kommen im Sinne der Evolution hin zur großen Kooperation und Nächstenliebe …
Eine schwierige Frage bei dem Ganzen ist: Wie ist das mit der Gerechtigkeit Gottes? Das ist ein Attribut, das Gott seit dem AT zugeschrieben wird und das in der Bibel zentral ist. Wenn er aber nun grundsätzlich keinen Unterschied zwischen Sündern und Gerechten macht (er lässt die Sonne über beiden aufgehen) – ist das gerecht? Gibt es keine Strafe für wirklich absichtlich böse Menschen? Wie ist das zu denken mit der Rechtfertigung derer, die leiden mussten? Der Theologe Ottmar Fuchs hat sich das so gedacht, dass – wenn wir nach unserem Tod in die Sphäre gelangen, wo wir erkennen, dass Liebe und Kooperation das Ziel und die Erfüllung des Lebens sind, und wir all unsere Taten im Leben in diesem Licht betrachten – wir entweder so geschockt sind, völlig daneben gelegen zu haben, oder aber uns so bestätigt fühlen, auf dem richtigen Weg gewesen zu sein, dass dies Hölle und Himmel sind …
Autorin Simone Brietzke ist Dipl.-Biologin und Prädikantin