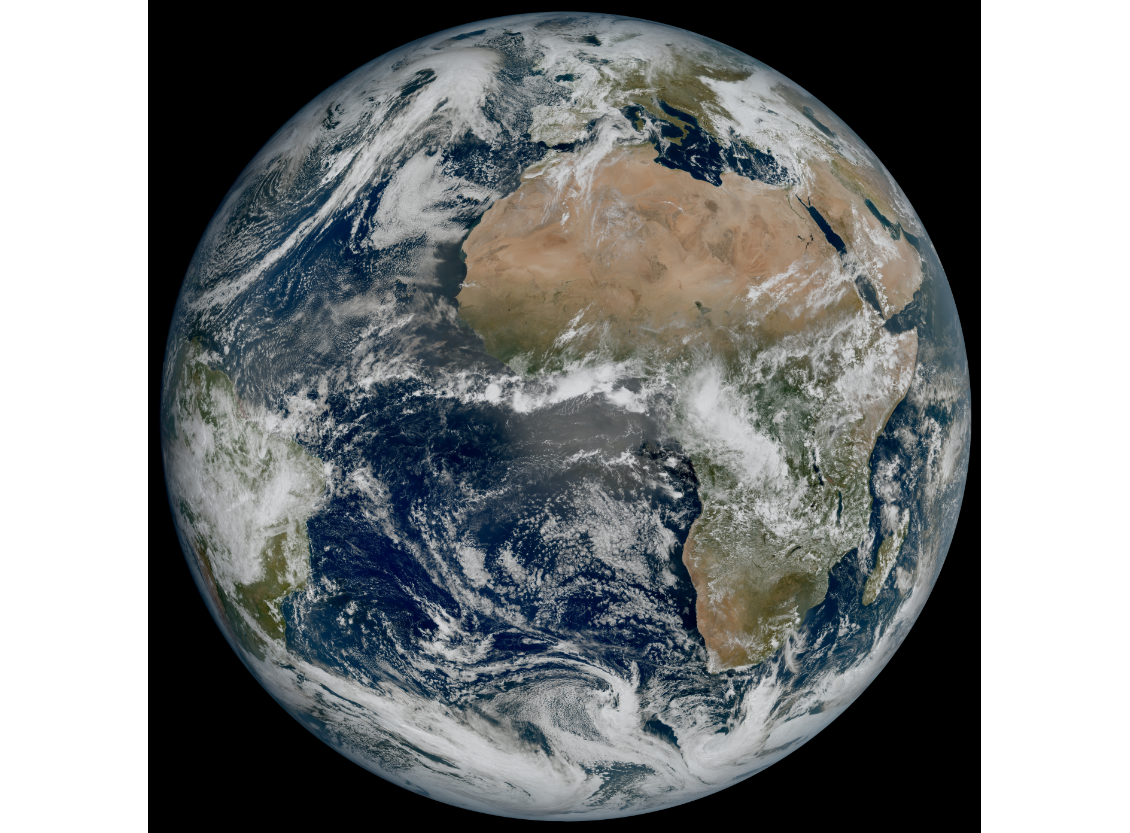Die Entfremdung der Menschen von den christlichen Glaubenswahrheiten

Die Kirche: "erneuern oder untergehen"
1) Schlechtes Image der Kirche
Den Großkirchen in Deutschland, die gar nicht mehr so groß sind, geht es schlecht. Anhaltend hohe Kirchenaustritte lassen sie immer weiter schrumpfen. Die Kirchen haben seit Jahren ein schlechtes Image, die gesellschaftliche Stimmung richtet sich gegen sie. Man bekommt in der Öffentlichkeit das Gefühl vermittelt: So viele treten aus, wäre es nicht besser, ebenfalls auszutreten? Kirche? Man streitet nicht mehr mit ihr oder um sie; sie erzeugt meist nur noch ein müdes Lächeln und Gähnen.
Wir kommt das? Drei Gründe werden oft genannt, die zum rasanten Bedeutungsschwund des Protestantismus beigetragen haben:
(1) Die Formen in den evangelischen Kirche sind veraltet. Sie entsprechen nicht dem Lebensgefühl heutiger Menschen. Das bezieht sich in erster Linie auf den Gottesdienst mit seiner steifen Liturgie, den alten Liedern und dem für junge Menschen leicht skurrilen Outfit der Pfarrperson mit Talar und Beffchen bzw. Halskrause. Auch die Außendarstellung der Kirche wirkt auf viele Menschen wenig attraktiv. Die Präsenz der Kirche in den Medien ist klischeehaft: Schon an der salbungsvollen Stimme kann man kirchliche Radiosendungen erkennen. Das sind ein paar Beispiele, die für viele stehen und deutlich machen: Die Formen der Kirche wirken auf heutige Menschen insgesamt altbacken und altmodisch.
(2) Ein weiterer Grund: Die Dimension des Erlebens ist für heutige Menschen zentral. Sie wollen emotional von etwas berührt sein. Aber die protestantische Kirche ist kognitiv ausgerichtet, sie ist eine Kirche des Wortes. In der evangelischen Kirche wird viel gesprochen und belehrt. Man stelle sich nur einmal einen tauben Menschen in einem Gottesdienst vor: Vom Erlebnischarakter her ein echtes Desaster!
(3) Ein dritter Grund für das Schwinden der Kirche wird immer wieder genannt: Die protestantische Kirche erscheint in den Augen vieler heutigen Menschen als unglaubwürdig. Und daran sind nicht nur die Missbrauchsfälle schuld, die es, wie wir inzwischen wissen, auch in der evangelischen Kirche gibt. Als unglaubwürdig gilt die Kirche aber auch ganz allgemein: Sie lebt ihre Ideale nicht. Stattdessen wird sie wahrgenommen als Institution, in der es wie bei jeder Institution immer auch um Macht und Einfluss geht.
2) Besseres Image der Freikirchen?
Das Image einiger Freikirchen scheint weitaus besser: Ihre Gottesdienste haben Emotionalität und ziehen jüngere Menschen an, die nie in einen Gottesdienst der Großkirchen gehen würden. Die Musik ist modern und mitreißend, die Ansprachen sind in einer einfachen Sprache gehalten und es gibt in ihnen auch mal etwas zu lachen. Freikirchen investieren viel in moderne Technik und Medien. Sie haben ein professionelles Marketing. Und sie versuchen, ihre Überzeugung auch zu leben. Meist bestehen sie aus lebendigen Gemeinschaften.
Viele in den protestantischen Landeskirchen sind der Meinung: Wenn wir das auch so machen wie die Freikirchen, dann kommen auch wieder die Menschen zu uns.
So wichtig ich moderne, lebendige Formen und gelebte Ideale finde: Die Meinung, man sollte die Freikirchen imitieren, dann kommen die Leute wieder in Scharen zu uns, halte ich für einen Trugschluss. Man braucht sich dazu nur die neuesten Prognosen anschauen. Eine Schweizer Untersuchung, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, weist in die gleiche Richtung wie die neueste Mitgliedsuntersuchung der EKD. In dieser Prognose wird ein Trend deutlich benannt: Die Landeskirchen nehmen weiter rasant ab. Ein kleiner Teil von ihnen wandert ab zu den Freikirchen, aber auch ein Teil der Freikirchen wandert umgekehrt zu den Landeskirchen. Beide verlieren jedoch miteinander immer weiter an Boden: Die allermeisten Menschen der zukünftigen Gesellschaft sind zunächst kirchendistanziert und später dann kirchenlos. Von da gelangen sie nur noch in den seltensten Fällen zurück zur Kirche. Man nennt das "säkulares Driften".
3) Das Inhaltsproblem der Kirche
Das Problem der Landeskirchen sind demnach nicht nur und nicht einmal in erster Linie veraltete Formen, mangelnder Erlebnischarakter und fehlende Glaubwürdigkeit. Auch eine modern aufgepeppte Kirche erreicht die Menschen heutzutage immer weniger. Was ist dann das Problem der Kirche? Meine These ist: Es sind vor allem die Inhalte der Kirche, der Landeskirchen und der Freikirchen, mit denen die Menschen heutzutage nicht mehr viel anfangen können. Die Bibel als Wort Gottes, Gott als Person, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, Jesus als Sohn Gottes, der die Menschen von ihren Sünden erlöst, indem er für sie am Kreuz stirbt, Jesu Wunder, seine Auferstehung und Himmelfahrt, das Jüngste Gericht, ewiges Leben: Nahezu alle traditionellen Glaubensinhalte der Kirche – die im Apostolischen Glaubensbekenntnis Sonntag für Sonntag im Gottesdienst bezeugt werden – werden von heutigen Menschen, auch von Kirchenmitgliedern, immer weniger geglaubt. In Befragungen, die regelmäßig erhoben werden, kommt dies deutlich zum Vorschein.
Man muss nur einmal Menschen aus dem weiteren Bekanntenkreis, die nicht kirchlich sind, auf christliche Inhalte ansprechen und hören, was sie dazu sagen. Oder man schaue in die Todesanzeigen der Tageszeitung. Früher stand oben auf der Anzeige in der Regel ein Bibelvers. Heutzutage findet sich da zumeist ein Sinnspruch, der zum Ausdruck bringt, dass man den Toten schmerzlich vermisst und er in den Herzen der Angehörigen weiterlebt. Von einer Auferstehungshoffnung ist keine Rede mehr.
Die immer weiter zunehmende Entfremdung der Menschen von den traditionellen Glaubensinhalten erklärt auch, warum die Beteiligung am Gottesdienst so gering ist: Im Gottesdienst geht es darum, Gott zu loben und sein Wort zu hören. Der Gottesdienst setzt also eine gläubige Haltung voraus. Wenn aber viele Menschen immer weniger an Gott glauben, auch innerhalb der Kirche, warum sollten sie am Gottesdienst teilnehmen?
Die Kirche hat ein massives Inhaltsproblem. Wenn sie eine grundlegende Erneuerung wollte, müsste sie sich diesem Problem stellen. Sie müsste sich fragen, warum die Menschen immer weniger die Glaubensüberzeugungen der Kirche teilen. Aber das tut die Kirche nicht. Was sie in Angriff nimmt, sind kosmetische Oberflächenpolierungen: Sie will flotter und cooler rüberkommen. Das alleine wird aber nichts nützen. Wenn die Kirche sich dem Problem der Inhalte nicht stellt, wird sie untergehen.
Meine folgenden Überlegungen werden um dieses Problem der Inhalte kreisen. Wie kommt es dazu, dass die traditionellen Inhalte der Kirche immer weniger geglaubt werden? Und wie könnte die Kirche mit diesem Problem umgehen?
4) Die Entfremdung der Menschen von christlichen Glaubenswahrheiten hat eine lange Geschichte
Die Entfremdung der Menschen von den traditionellen Inhalten der Bibel ist keine Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Sie dauert schon viel länger und reicht mindestens bis an den Anfang der Neuzeit. Ein deutlicher Schub in Richtung einer kirchenkritischen Haltung war die Aufklärungszeit. Spätestens in dieser Zeit emanzipierte sich die naturwissenschaftliche Weltsicht endgültig von dem bisherigen, christlich grundierten Weltbild. Die naturwissenschaftliche Weltsicht betrachtet die Welt in einer Art und Weise, die das Christentums als Konkurrenz zu seiner eigenen Weltsicht ansah. In der Aufklärungszeit traten zudem durch die vielfältigen Entdeckungen anderer Länder bisher weitgehend unbekannte Religionen stärker ins Bewusstsein, die ebenfalls Wahrheit für sich beanspruchten und dadurch als Konkurrenz zum Christentum angesehen wurden.
Die Kirche konnte durch ihre starke gesellschaftliche Stellung die latenten Infragestellungen durch die Naturwissenschaften und andere Religionen lange in Schranken halten. In der heutigen Zeit immer stärkerer Individualisierung und Pluralisierung hat die Kirche die Deutungshoheit jedoch verloren und es gewinnen christentumskritische Sichtweisen immer mehr die Oberhand.
5) Der traditionelle Gottesglaube: Ein Beispiel für die Infragestellung des christlichen Glaubens
Ich will die Infragestellung des christlichen Glaubens in der heutigen Zeit an einem Beispiel, dem Thema Gott, verdeutlichen. Gott: darum geht es im Christentum zentral, an ihm hängt die ganze traditionelle Theologie. Nicht zufällig heißt es ja auch Theo-logie: Gotteslehre. Der Glaube an Gott nimmt in Deutschland immer weiter ab. Das hat vielerlei Gründe:
a) Die Naturwissenschaft als in heutiger Zeit zentrale Weltsicht kommt ohne die Gotteshypothese aus. Um die Welt zu erklären, wird Gott nicht mehr gebraucht. Gläubigen Menschen fällt es in Zeiten naturwissenschaftlichen Denkens zunehmend schwer, Gott zu verorten. Wo Gott ist: Darauf wissen sie immer weniger eine Antwort.
b) Die christliche Gottesvorstellung wird außerdem durch die Existenz anderer Religionen in Frage gestellt. In ihnen gibt es andere Gottes- und Göttervorstellungen, wenn sie nicht gar, wie der Buddhismus, ohne Gott auskommen. Wenn man schon an Gott glaubt: Warum sollte man an den christlichen Gott glauben und nicht beispielsweise an Shiva?
c) Aber ist der Gottesglaube heute überhaupt noch zeitgemäß? Der Philosoph Ludwig Feuerbach erklärt die Gotteshypothese ganz allgemein als menschliche Projektion: Nicht Gott – wie es in der Bibel heißt – schuf sich den Menschen zu seinem Bilde. Es ist genau umgekehrt: Der Mensch schafft sich Gott zu seinem Bild.
d) Und schließlich gibt es einige binnentheologische Probleme, die die Gottesthematik betreffen: Gott befiehlt im Alten Testament Kriege und ruft zu Gewalt auf. Das schreckt heutzutage viele Menschen ab. Grundsätzlicher ist das Theodizeeproblem: Wie bringt man das Böse ganz allgemein mit einem liebenden Gott in Vereinbarung?
6) Notwendigkeit einer Neubegründung des Christentums
Bis in die Neuzeit stand die Naturwissenschaft unter hohem Rechtfertigungsdruck vor dem Forum des Christentums. Heute ist es umgekehrt: Das Christentum, ja Religion ganz allgemein muss sich rechtfertigen vor dem Forum der Wissenschaft. Ist Religion nur eine Illusion? Opium des Volkes, wie Marx sagte? Der Gottesglaube eine infantile Vatersehnsucht, wie Freud gemeint hat?
Die Infragestellung des Christentums in heutiger Zeit bezieht sich nicht nur auf einzelne Inhalte. Sie ist fundamental. Der Mathematiker und Philosoph Auguste Comte – um ein prominentes Beispiel zu nennen – unterschied drei Stadien der Geschichte. Diese drei Stadien verglich er mit der Entwicklung eines Menschenlebens: Das erste Stadium ist das religiöse. Da ist der Mensch noch ein Kind. Nach dem zweiten Stadium, einem Übergangsstadium, ist dann mit dem dritten Stadium das Zeitalter der Wissenschaft erreicht. Mit ihm ist der Mensch erwachsen geworden.
Diese Anschauung Comtes teilen heutzutage viele Menschen, auch wenn sie Comte nicht direkt kennen. Es ist für sie deshalb nicht überzeugend, wenn wir Christen – wie wir das gerne tun – von der Offenbarung Gottes als einer unhintergehbaren Tatsache ausgehen. Das war vielleicht noch in Zeiten plausibel, in denen man in das Christsein durch den Glauben der Eltern, Verwandten und Bekannten organisch hineinwuchs. Heute nehmen Menschen das Christentum aber in der Regel von außen wahr. Sie wollen eine plausible Begründung, wenn sie sich auf das Christentum einlassen sollen.
7) Was ist eigentlich Religion?
Wie könnte eine solche Begründung aussehen? Gehen wir für ein paar Momente in das Jahr 1799 zurück, um darauf eine Antwort zu finden! Das Ende des 18. Jahrhunderts ist eine Zeit tiefer theologischer Krise. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant hatte öffentlichkeitswirksam alle Gottesbeweise, von denen die christliche Theologie als Begründung ihrer Existenz ausgegangen war, denklogisch zertrümmert. Alleszermalmer hatte man Kant genannt. Es schien, als sei die bisherige Theologie an ihr Ende gekommen. Dass Kant für Gott noch ein kleines Hintertürchen, als sinnvolles Denkpostulat, offengelassen hatte, half nicht viel. Dieses Türchen war zu klein, als dass die traditionelle Theologie hindurchgepasst hätte.
Wie auf Kants Gotteszertrümmerung reagieren? Viele Theologen hofften, dass über Kants Ansichten bald Gras wüchse, andere ignorierten ihn einfach. Die Situation war ein wenig so, wie heute in der kirchlichen Praxis mit der Infragestellung der Religion und des Christentums umgegangen wird: Man nimmt die Herausforderung nicht an, macht weiter wie bisher und nimmt es hin, dass die Gebildeten immer mehr auf Abstand gehen.
Da erschien 1799 eine kleine Schrift eines bis dato Unbekannten: „Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.“ In ihr stellte sich Schleiermacher, ein junger Theologe, der Herausforderung durch Kant. Zunächst einmal erkannte er Kants Widerlegung der traditionellen Gottesbeweise an. Das war mutig. Aber, sagt Schleiermacher, Kant verkennt den eigentlichen Charakter von Religion. In ihr geht es gar nicht um Metaphysik, also um die denkerische Durchdringung der Wirklichkeit und die Aufstellung von Seinsaussagen. Gottesbeweise? Damit soll sich die Philosophie beschäftigen, meint Schleiermacher. In Religion geht es auch erst einmal nicht um Moral. Moral wächst der Religion erst allmählich zu. Was ist Religion aber dann? Grundlegend für Religion sind Schleiermacher zufolge außerordentliche Erfahrungen. In besonderen Momenten ihres Lebens kann es passieren, dass Menschen das Gefühl haben, dass die gewohnte Welt aufreißt und sie eine Ahnung bekommen von etwas Größerem. Religion, sagt Schleiermacher, ist „Sinn und Geschmack für das Unendliche“. Menschen, die diese Wirkung der Wirklichkeit auf sich erleben, deuten die Realität als Teil eines größeren Ganzen. Sie nehmen sie als großes Geheimnis wahr und fühlen sich zugleich mit ihr tief verbunden. Der berühmte Physiker Albert Einstein hat das einmal sehr schön so formuliert: „Das schönste Gefühl, das wir erleben können, ist das Mysterium. Wem dieses Gefühl fremd ist, wer sich nicht mehr wundern und andächtig innehalten kann, ist so gut wie tot, eine erloschene Kerze. Religiosität besteht darin, dass man hinter allem, was man erfahren kann, etwas erahnt, das unser Verstand nicht greifen kann; etwas, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur indirekt erreicht. In diesem Sinne ... bin ich ein zutiefst religiöser Mensch.“ Das, was Einstein sagt, ist ganz im Sinne Schleiermachers.
Zwei Komponenten kommen bei Religion zusammen: Ein tiefes Gefühl – und ein spezifisches Verständnis von Wirklichkeit. Beide Komponenten von Religion bedingen sich gegenseitig: Gefühle der besonderen Art lösen eine religiöse Deutung aus. Und umgekehrt gilt: religiöse Wirklichkeitsdeutung kann entsprechende Gefühle auslösen.
Als spezifische Deutung von Wirklichkeit ist Religion etwas ganz Anderes als naturwissenschaftliches Analysieren der Wirklichkeit im Blick auf ihre Funktionsweisen. Von daher gibt es keine wirkliche Konkurrenz zwischen diesen beiden Weltsichten. Man muss ehrlicherweise sagen: Dass man Religion und Naturwissenschaft als Konkurrenz angesehen hat, das ging nicht nur von der Naturwissenschaft aus, sondern, wie schon angedeutet, auch vom Christentum, sehr zum Schaden seiner selbst.
8) Symbolisierung der religiösen Erfahrung
Religiöses Erleben ist ein flüchtiger Moment, wenn es nicht kommuniziert wird. Was man erlebt hat, kann man versuchen zu malen, zu besingen oder man nutzt – und das geschieht vor allem – dafür die Sprache. Schleiermacher spricht von „Symbolisierung“ als dem Versuch, Erlebnisse auszudrücken. Über religiöse Empfindungen zu sprechen ist allerdings eine große Herausforderung. Wie soll das gehen, von etwas zu reden, was sich der Greifbarkeit entzieht? Religiöse Sprache ist deshalb ein Tasten, ein immer wieder neuer Versuch, zum Ausdruck zu bringen, was den Alltagshorizont überschreitet. Hierfür braucht es besondere sprachliche Mittel. Religiöse Sprache verwendet hierfür Metaphern und Symbole. Metaphern vergleichen das letztlich nicht Sagbare, über das sinnliche Erleben Hinausgehende, mit etwas aus dem alltäglichen Leben, um eine Ahnung von dem ganz Anderen zu vermitteln. Symbole haben neben der wörtlichen Bedeutung einen Tiefensinn, um den es eigentlich geht. Metaphern und Symbole können uns eine Ahnung geben von dem Nichtgreifbaren.
9) Inhaltliche Probleme der Kirche heute
Soweit Schleiermachers religiöser Ansatz, den ich für sehr plausibel halte und der in den letzten Jahrzehnten in der Theologie wieder stark rezipiert wird. Wenn wir von ihm ausgehen, können wir verstehen, warum das Christentum in unserer heutigen Zeit immer weiter an Bedeutung verliert:
• Wir haben aus der symbolisch-metaphorischen Sprache der Bibel ein starres Glaubenssystem geformt: Es besteht aus einzelnen Lehren, Dogmen genannt. Es wird nicht mehr deutlich, dass die religiöse Sprache der Bibel ein vielgestaltiges Tasten, ein sprachliches Wagnis, ein letztlich unzulänglicher Versuch darstellt, etwas in Worte zu fassen, was kaum in Worte zu fassen ist.
• In den Dogmen, den Lehrsätzen, ist der religiöse Erfahrungshintergrund der Bibel nicht mehr erkennbar. Dadurch wird das ganze Glaubenssystem zu einer reinen Behauptung.
Die Lehrgebäude der Theologie, die sich auf biblische Deutungsansätze beziehen und sie in eine Begriffssprache überführt haben, formulieren in fast mathematischer Klarheit, was Inhalt des Christentums ist:
Gott – das sind drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus hat zwei Naturen: eine göttliche und eine menschliche Natur, sie sind unvermischt und ungetrennt. In welche Gedankengänge Theologie hineingeraten kann, wird an der Frage deutlich, was nach dem Tod mit den Menschen passiert: Alle kommen sie ins Jüngste Gericht. Da aber die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten sterben, das Jüngste Gericht jedoch für alle gleichzeitig sein wird, erdachte man sich einen Warteraum, in dem die Menschen sich so lange aufhalten, bis sie gemeinsam ins Jüngste Gericht gehen. In ihm kommt nur derjenige sicher in den Himmel, der an die Genugtuungsleistung Jesu glaubt: Denn nur sein Opfertod kann dem Anspruch Gottes gerecht werden.
Das sind einige der zentralen dogmatischen Lehren der christlichen Theologie. Das alles, behaupte ich, versteht ein normaler Mensch nicht. Schlimmer: Das glaubt niemand mehr. Und am allerschlimmsten: Das hat mit dem, worum es nach Schleiermacher bei Religion eigentlich geht, nicht mehr viel zu tun.
All diese vielen gedrechselten Lehrsätze, die im Laufe der Christentumsgeschichte entwickelt worden sind, versperren vielen Menschen heutzutage den Zugang zum Christentum, weil sie Behauptungen aufstellen, die Menschen weder durch ihre Erfahrung gedeckt erleben, noch von ihrem Denken her ihnen plausibel erscheinen. Die traditionellen Lehren der Theologie beherrschen uns bis heute. Sie stehen hinter der kirchlichen Praxis. Man muss nur einmal auf die Seiten evangelisch.de und ekd.de gehen und den Begriff Jüngstes Gericht eingeben. Da kann man staunen bzw., um es etwas drastischer zu sagen, da kann es einen gruseln, was da an traditioneller Lehre durchschimmert. Ich verstehe sehr gut, dass heutige Menschen immer weniger bereit sind, solchen Lehren Wahrheit zuzumessen.
Wir haben ein massives Inhaltsproblem, habe ich anfangs gesagt. Ja, das haben wir wirklich. Wir brauchen eine Neubesinnung auf das, was den Kern unseres Christentums ausmacht. Folgen wir dem Theologen Schleiermacher, dann ist das Christentum wie jede Religion eine spezifische Wirklichkeitsdeutung. Sie gründet sich auf ein besonderes religiöses Erleben und ist in symbolisch-metaphorischer Sprache gefasst. Von diesen Determinanten ausgehend haben wir als Christen die große Aufgabe, unsere Inhalte in neuer Weise zum Ausdruck zu bringen. Das will ich im Folgenden versuchen: Ich nehme einige der großen christlichen Themen in den Blick, benenne traditionelle Missverständnisse und wage eine neue Sicht unserer christlichen Inhalte.
10) Neue Sicht auf zentrale christlicher Inhalte
a) Gott
Ich bin der Meinung, dass die meisten Missverständnisse des Christentums mit diesem Thema zusammenhängen. Gott wird traditionell verstanden als eine Art personales Wesen. Mit diesem Verständnis manövriert man sich allerdings in unlösbare Probleme hinein: Wo ist dieses Wesen? Wie spricht es zu den Menschen? Warum hat es die Welt nicht besser erschaffen? Warum befiehlt es Kriege (so im Alten Testament)? Warum erhört es viele Gebete nicht? Und was ist mit den Göttern in den anderen Religionen?
Angesichts dieser Infragestellungen ist es unsere Aufgabe als Theologen, das Reden über Gott noch einmal ganz grundsätzlich in den Blick zu nehmen. Zunächst ist erst einmal zu sagen: Gott, das ist in der Bibel der Name, die Chiffre für das von mir vorhin beschriebene besondere religiöse Erleben der Wirklichkeit und der Deutung ihrer als Teil eines größeren Ganzen. Die Israeliten verbanden diesen Namen mit den hellen, erfolgreichen Momenten ihrer wechselvollen Geschichte – Erfahrungen des Vertrauens, der Befreiung, der Gerechtigkeit – ebenso wie mit Dunkel und Selbstzweifel.
Alle Rede von Gott in der Bibel ist, weil es um etwas geht, das die sichtbare Welt überschreitet, notwendigerweise metaphorisch und symbolisch. Viele unterschiedliche Metaphern und Symbole enthält die Bibel hierfür, entsprechend der vieldimensionalen Wahrnehmung des Geheimnisses „Gott“: Gott wird verglichen mit der lebensspendenden Kraft der Sonne, mit der Fürsorge eines Hirten oder einer Mutter, mit dem Beschütztsein in einer Burg, mit der Lebendigkeit eines lodernden Feuers. Gott wird aber auch verglichen mit dem uns umgebendem Wirklichkeitsraum, in dem wir leben und weben.
All diese Symbole und Metaphern – es gibt noch viel mehr – sind sprachliche Versuche. Sie wollen zum Ausdruck bringen, dass der Mensch sich angerührt fühlt von etwas unendlich Großem, in dem er sich geborgen und herausgefordert fühlt und das bei ihm Staunen, Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit freisetzt.
Wir Christen haben aus der Fülle der biblischen Gottesmetaphern und -symbole vor allem eine Metapher herausgenommen: Gott als der himmlische Vater. Weil wir nur noch diese eine Metapher haben und sie verabsolutieren, verliert diese Bezeichnung ihren metaphorischen Charakter und wird zur Sache selbst: Gott ist für uns nicht mehr wie ein himmlischer Vater, er ist der himmlische Vater. Kein Wunder, wenn bei Kindern die Vorstellung eines alten Mannes entsteht, der auf den Wolken thront. Diese Vorstellung zerbricht spätestens im Jugendalter, danach verstehen sich die meisten als religionslos. Das kann man tagtäglich im Religionsunterricht in den weiterführenden Schulen erleben.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute in neuer Weise von Gott reden müssen:
• Wir sollten darauf aufmerksam machen, dass hinter dem Wort „Gott“ ein religiöser Erlebenshintergrund steht. Gott ist die Chiffre, der Name für ein außerordentliches Erleben und die Deutung der Wirklichkeit als Teil eines größeren Ganzen.
• Wir sollten klar benennen, dass Gottesvorstellungen immer menschliche Deutungen für dieses Erleben sind.
• Wir sollten von Gott in vielen und unterschiedlichen Metaphern und Symbole sprechen, weil nur so das Geheimnis Gottes gewahrt bleibt. Damit sollten wir zugleich eingestehen, dass unser Reden von Gott immer nur ein Versuch, ein Tasten darstellt.
• Wir sollten uns durch die vielen biblischen Metaphern und Symbole anregen lassen, neue Symbole und Metaphern zu kreieren. Manche Gottesmetaphern und -symbole sollten wir hingegen aufgeben, wenn sie uns unpassend erscheinen, zum Beispiel die Rede von Gott als Kriegsmann (Ex 15,3).
• Überhaupt sollten wir uns bewusst machen, dass personale Bilder eine menschlich-allzumenschliche Vorstellung von dem großen Geheimnis „Gott“ sind und häufig zu Missverständnissen führen. Wenn man einmal begonnen hat, Gott mit einer Person gleichzusetzen, dann bekommt das eine Eigendynamik und Eigenlogik: Wir sprechen dann davon, was Gott sagt, was er will, wie er auf uns schaut ... Das Bild einer Person wird zu einer metaphysischen Realität mit allen ausweglosen Problemen, die ich vorhin benannt habe. „Du sollst dir kein Bild von Gott machen“, heißt es in der Bibel. Permanent durchbrechen wir dieses Gebot. Die Bibel selbst tut das übrigens leider auch!
Ein solches Verständnis von Gott, wie ich es skizziert habe, hat Auswirkungen, zum Beispiel auf das Beten. Es geht beim Beten nicht mehr darum, Bitten an eine überweltliche Person zu richten und auf ihre Erfüllung zu hoffen. Gebet ist vielmehr in einem tieferen Sinne die meditative Übung, sich einem Horizont zu öffnen, der unseren Alltagshorizont unendlich überschreitet, und sich in bzw. unter ihm geborgen zu wissen.
b) Die Bibel
Die Bibel ist kein Tatsachenbericht, sondern, so hat es eine Schülerin einmal treffend gesagt, besteht aus Sinnbildern. Weil die Bibel eine Bildwelt ist, darf man ihre Inhalte nicht als Fakten missverstehen. Das wäre ganz gegen ihren Sinn. Es geht in ihr um symbolische Deutung der Wirklichkeit. Die Bibel ist auch nicht irrtumslos. Wie sollte sie das auch sein? Sie ist ein Kind ihrer Zeit mit den Werten und Einstellungen, die damals gegolten haben. Wir sollten deshalb nicht alles in der Bibel 1:1 für uns übernehmen. Unsere heutige Welt steht zum Teil vor anderen Herausforderungen als die Welt damals. Unsere Aufgabe ist es, immer wieder neu herauszufinden, was wir aus ihr als Impulse für unser heutiges Leben gewinnen können.
c) Schöpfung
Die Schöpfungstexte. die uns ganz am Anfang der Bibel begegnen, sind keine antike Weltentstehungstheorie und deshalb auch nicht als Konkurrenz zu wissenschaftlichen Theorien wie dem Urknall zu verstehen. Worum geht es in den biblischen Schöpfungserzählungen dann und was ist ihr bleibender Wert für uns Menschen heute?
• Sie erinnern uns daran, dass die Entstehung der Welt trotz aller naturwissenschaftlichen Erkenntnisse immer ein Rätsel bleibt.
• Sie bringen das Staunen zum Ausdruck, dass überhaupt etwas existiert und nicht vielmehr nichts.
• Sie betrachten die Welt, als ob ihr ein Sinn innewohnt.
• Sie leiten uns an, die Schönheit der Welt wahrzunehmen.
• Sie halten uns vor Augen, dass die Welt nicht unser Besitz ist.
• Zugleich schärfen sie uns ein, dass wir Menschen Verantwortung für das Schicksal der Welt tragen.
d) Der Fall des Menschen
Direkt nach den Schöpfungserzählungen erfolgt in der Bibel die Erzählung von dem sogenannten Sündenfall. Dieser Sündenfall erzählt nicht von etwas, was genau so einmal stattgefunden hat. Das wäre viel zu wenig. Denn eigentlich geht es in dieser Erzählung um uns alle. Das kommt schon in den Namen zum Ausdruck: „Adam“, das ist der Mensch. Und „Eva“, das ist die Leben Schenkende, also die Frau. In der tiefsinnigen Erzählung von Adam und Eva kommt die Erfahrung zum Ausdruck, dass der Mensch nicht einfach gut ist, wie es in der Schöpfung von ihm heißt. In ihm lauern Abgründe. Beides macht den Menschen aus: Glanz und Elend. Größe und Diabolisches. So ist der Mensch! Wir sollen uns keine falschen Illusionen von ihm machen. Dadurch, dass der Erzählung vom Sündenfall die Schöpfungserzählung vorgeschaltet wird, in der der Mensch positiv geschildert wird, wollen die Redaktoren der Bibel jedoch sagen: Der Mensch lebt entfremdet von sich selbst. Seine Bestimmung ist eine andere.
e) Jesus
Für Christen spielt im Zusammenhang der eigentlichen Bestimmung des Menschen die Person Jesus von Nazareth eine entscheidende Rolle. Schon im Neuen Testament mit Hoheitstiteln ausgestattet, wurde Jesus sehr bald in der Geschichte des Christentums zu einem Himmelswesen erhoben. Mit dieser Tendenz zur immer steileren Dogmatisierung versperren wir Christen uns jedoch immer mehr den Zugang zu dem, worum es dem gläubigen Juden Jesus eigentlich ging. Wegweiser wollte er sein, Wegweiser zu einem erfüllten Leben. Sozusagen Wegweiser zurück zum verlorengegangenen Paradies.
Im Zentrum seiner Lehre, so berichten es die Evangelien, steht das „Reich Gottes“, wie er es genannt hat. Reich Gottes: Das ist Jesu Vorstellung einer heilen Welt, von der er absolut überzeugt und gänzlich durchdrungen war. Eine Welt des Friedens und der Versöhnung – untereinander und jeder mit sich selbst. Niemand geht im Reich Gottes verloren, sondern wird geliebt und geachtet, ohne in Vorleistung gehen zu müssen, und hat seine unverlierbare Würde. An dieser Welt, die schon da ist und sich immer mehr durchsetzen wird, hat jeder Anteil, indem er sie aufnimmt und wirken lässt.
Die Wunder Jesu – spätere Deutungen der Person Jesu – sollen Jesus nicht als Zauberer darstellen. Wir können sie als visionäre Vorabbildungen der heilen Welt verstehen, um die es Jesus ging. In diesen Wundern ist die heile Welt schon endgültige Gegenwart geworden. In gewisser Weise umgekehrt verhält es sich mit Jesu Rede vom Weltgericht. Darin entwirft er ein endzeitliches Szenario, um seinen Zuhörenden vor Augen zu führen, worauf es hier und jetzt ankommt:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, sagt Jesus im Rückgriff auf das Alte Testament. Um lieben zu können, muss man auch sich selbst lieben können. Beides gehört zusammen und bedingt einander. Aber noch ein Zweites gehört für Jesus als gläubigem Juden dazu, um lieben zu können: sich in Gott, dem großen Ganzen, geborgen zu wissen. Dieser göttlichen Geborgenheit versicherte sich Jesus als im Gebet, indem er sich immer wieder zurückzog in die Einsamkeit. Aus diesen Rückzugszeiten schöpfte er Kraft und Orientierung. Er wusste sich von der göttlichen Wirklichkeit umhüllt und in ihr aufgehoben. Diese Resonanzerfahrung war für ihn zentral.
Das Reich Gottes: eine Welt, die man sich nach Jesu Worten schenken lassen muss wie ein Kind. Jesu Verkündigung ist in diesem Sinne Anleitung, die Welt neu wahrzunehmen: „Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Und die Lilien auf dem Felde!“ Im Alltäglichen das Wunderbare zu erkennen, im Kleinen das große Ganze durchscheinen zu sehen und sich so in einem umfassenden Sinne geborgen und behütet zu wissen: Das ist eine wichtige Voraussetzung, um selbst lieben zu können.
Das Reich Gottes ist Jesu große Vision einer heilen Welt. Seit 2000 Jahren hält diese Vision Menschen in Atem. Für uns moderne Menschen stellt sie eine Gegenwelt dar zu all dem, was heute zählt: Leistung, Aussehen, Geld, Macht, Erfolg. Das alles hat Jesus überhaupt nicht interessiert. Mehr noch: in all diesen Dingen, die uns heute so wichtig sind, sah er Hindernisse auf dem Weg zu der neuen Welt, die ihm vorschwebte. Ihm ging es um eine Verwandlung der Menschen von innen her. Das war seine „Revolution“.
Es wird Zeit, dass wir Jesu Botschaft wieder ins Zentrum stellen, die hinter der Dogmatisierung seiner Person immer mehr vergessen wurde. Schon Paulus hat sich für Jesu Botschaft wenig interessiert. Ihm taten es viele Theologen nach, sehr zum Schaden des Christentums. Denn in der Reich-Gottes-Botschaft stecken viele Anregungen für ein erfülltes, gelingendes Leben! Und ist das nicht genau das, wonach wir uns alle sehnen?
Mit seiner Sicht einer heilen Welt hat sich Jesus allerdings auch Feinde geschaffen. Das Establishment sah die eigene Stellung bedroht. So ziehen in den Evangelien schon bald dunkle Schatten auf, die sich immer mehr verdichten. Mit der Schilderung der letzten Tage in Jerusalem führen die Evangelien vor Augen, wie Jesus unschuldig in die Mühlen der Macht gerät. Aber er will sich nicht wehren, sondern seinem Weg der radikalen, uneingeschränkten Liebe bis zur letzten Konsequenz treu bleiben. Auch alle seine Freunde verlassen ihn. Bewegend sind seine Vergebungsworte an sie kurz vor seinem Tod. Indem wir uns mit dem Versagen der Jünger identifizieren, beziehen wir diese Vergebungsworte Jesu auch auf uns.
Qualvoll stirbt Jesus kurz darauf am Kreuz. Das Böse bekommt in diesem Drama ein Gesicht – aber damit ist es auch für jedermann bloßgelegt und erkennbar geworden. War es das, was Jesus mit seinem freiwilligen Tod auch bezwecken wollte?
Die Evangelien schließen ihre Schilderung des Lebens Jesu nicht mit seinem Kreuzestod ab. Das Ende ist noch nicht das Ende. In gewisser Weise geht es jetzt erst richtig los. Die Auferstehungserzählungen markieren diesen Neuanfang. Sie erzählen davon, dass seine Jünger Jesus wiedererkennen und ihn gegenwärtig erleben in Worten und Handlungen, die für ihn typisch waren und sie mit ihm verbinden. Veranlasst durch diese überraschende Erfahrung, wollen sie den Glauben an das Kommen des Reiches Gottes weitertragen und entsprechend leben und handeln, mit und durch Jesus. Ihn wissen sie in ihrer Mitte: als erlebbare Dynamik, die ihnen Flügel verleiht. „Heiliger Geist“ nennen die Evangelisten diese Art der Gegenwart Jesu. So machen sich die Jünger auf den Weg. Bald stoßen immer mehr zu ihnen – später auch Menschen, die keine Juden sind – und eine große Bewegung entsteht: die Kirche.
f) Kirche
Die Kirche ist von ihrem Selbstverständnis her Nachfolgeorganisation Jesu. Heutzutage wird sie allerdings im westlichen Europa zumeist als eine verblichene, starre Institution wahrgenommen, die nicht mehr in die heutige Zeit passt. Das war damals, vor fast 2000 Jahren, ganz anders. Die neuentstehende Kirche war hochattraktiv, sie war lebendig, innovativ, nah bei den Menschen. Rasant hat sie sich in den ersten Jahrhunderten über das ganze römische Reich ausgebreitet. Im Zuge einer immer stärkeren Institutionalisierung und Verrechtlichung entwickelte sich bei ihr die stete Gefahr, behäbig zu werden und zu erstarren. Je mehr sie Institution wurde, desto mehr wurden ihre Inhalte zu festgefügten Lehren. Die Sakramente, die sie spendete, nannte sie Heilsmittel. Die Reich-Gottes-Sicht Jesu hingegen verschwand immer mehr. Als Institution erlebte und erlebt die Kirche außerdem die ständige Verführbarkeit durch Geld und Macht.
So hat sich die Kirche immer mehr von dem entfernt, was sie einmal ausgemacht hat. Der protestantische Leitspruch „Ecclesia semper reformanda“ wird zwar hochgehalten, aber schnell wieder kassiert, wenn es an Reformen geht, die unbequem sind.
Wenn wir als Kirche heute wieder eine Rolle spielen wollen, müssen wir wieder zum Ursprung zurück: Nachfolgeorganisation Jesu sein, seine Reich-Gottes-Botschaft weitertragen und leben. Eine lebendige, aktive Überzeugungsgemeinschaft müssen wir wieder werden. In dieser Hinsicht können uns manche Freikirchen durchaus ein Vorbild sein.
„Ecclesia semper reformanda“: Ich träume davon, dass wir alles, aber auch wirklich alles in unserer Kirche auf den Prüfstand stellen und miteinander überlegen, was wirklich notwendig ist. Und vor allem, was wir nicht mehr brauchen oder anders brauchen.
g) Ewiges Leben
Noch kurz zum Thema „ewiges Leben“: Ewigkeit ist nach meinem Verständnis nicht zu verstehen als die Hoffnung auf eine Verlängerung des Lebens in einer ,jenseitigen‘ Welt, in der wir nach landläufiger Meinung unsere Verwandten und Freunde wiedersehen. Die vielen und zum Teil sehr unterschiedlichen biblischen Jenseitsaussagen sind Bilder für das nicht endende Aufgehobensein in einem größeren Ganzen, das wir Christen „Gott“ nennen und das wir im Diesseits schon erahnen können. Mit dem Aufgehobensein in einem größeren Ganzen schließt sich der Kreis, den ich mit der Neubestimmung des Themas „Gott“ begonnen habe.
11) Zweiter Schritt: Formale Erneuerung
Die inhaltliche Erneuerung von Kirche: das muss der erste Schritt sein. Ohne ihn geht es nicht. Es braucht aber dann weitere Schritte, die sich auf die Strukturen, die Formen und das Erscheinungsbild von Kirche beziehen. Was ich mir da vorstelle, will ich zum Schluss wenigstens kurz andeuten:
Die größte Baustelle scheint mir der Gottesdienst zu sein. Nur etwa 2% der Christen besucht durchschnittlich einen Gottesdienst. Das ist ein Zustand, der uns unruhig machen sollte. Der traditionelle Gottesdienst ist inhaltlich und formal ein echtes Fiasko. Wir werden um eine Kompletterneuerung des Gottesdienstes nicht herumkommen. Schon allein der Name „Gottesdienst“ ist ein Problem. Wenn uns eine umfassende Erneuerung des Gottesdienstes nicht gelingt, wird eine Erneuerung der Kirche fehlschlagen.
Wir brauchen darüber hinaus ein neues, modernes Erscheinungsbild von Kirche. Wir brauchen neue spirituelle Formen neben dem Gottesdienst. Wir brauchen mehr Lebendigkeit, mehr Authentizität, mehr Begeisterung. Wir brauchen ... ach, es ist so viel, was wir bräuchten. Und welche alten Zöpfe wir endlich abschneiden sollten!
Neuer Wein, hat Jesus einmal gesagt, gehört in neue Weinschläuche. Aber wir nutzen immer noch die alten Behälter, die immer mehr kaputtgehen und verschimmeln, als ob daran unser Leben hinge. Es ist ein bisschen wie mit dem Klimawandel: Wir wissen, dass wir nicht so wie bisher weitermachen können. Und dann machen wir doch so weiter!
Ich träume davon, dass wir Christen endlich zu neuen Ufern aufbrechen. Voller Wagemut, voller Enthusiasmus, voller Tatendrang, voller Idealismus. Wenn wir zu diesem großen Wagnis bereit wären, dann, ja dann könnte es mit der Kirche und dem Christentum vielleicht doch noch etwas werden!
Dr. Markus Beile