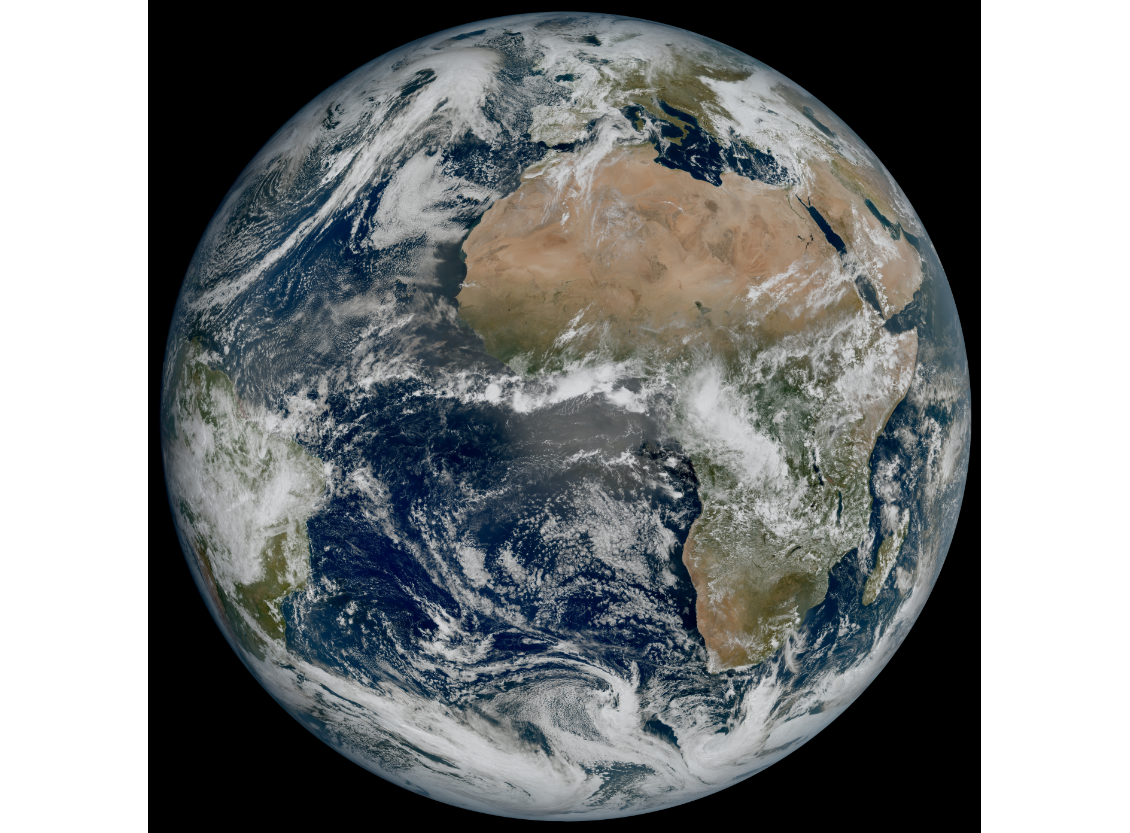Die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung "Wie hältst du's mit der Kirche? Zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft" wird hier von Prof. Dr. Werner Zager vorgestellt – mit den wichtigsten Ergebnisse und den Konsequenzen, die aus einer liberalen Sicht daraus zu ziehen sind.

„Wie hältst du’s mit der Kirche? Zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft“ – so ist die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) überschrieben, die vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD im Jahr 2022 durchgeführt worden ist.[1] Sie bezog sich auf die in Privathaushalten lebende Bevölkerung in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr, wobei sich – im Unterschied zu vorausgegangenen KMUs – unter den Befragten nicht nur Evangelische und Konfessionslose befinden, sondern auch Katholische und Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften.
Seit der ersten KMU 1972 sind erhebliche Veränderungen der konfessionellen Zusammensetzung in Deutschland eingetreten. Die Bevölkerung der damaligen BRD bestand zu dieser Zeit zu 46 % aus Mitgliedern der EKD-Gliedkirchen, zu 44 % aus Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche, zu 5 % aus Konfessionslosen sowie zu 5 % aus Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften. Im Jahr 1990, nach Beitritt des früheren DDR-Gebiets, veränderten sich die Zahlen deutlich: 37 % Evangelische, 36 % Katholische, 22 % Konfessionslose, 5 % Angehörige anderer Religionsgemeinschaften. Die Zahlen zum Zeitpunkt der Durchführung der 6. KMU Ende 2022 stellen sich so dar: 23 % Evangelische, 25 % Katholiken, 43 % Konfessionslose, 9 % Angehörige anderer Religionsgemeinschaften.
Im Folgenden möchte ich zum einen die wesentlichen Ergebnisse der 6. KMU zusammenfassen, ergänzt um sozialwissenschaftliche Erkenntnisse. Zum anderen möchte ich einige Konsequenzen aufzeigen, die aus meiner Sicht daraus zu ziehen sind. Nicht zuletzt soll es darum gehen, was dies für die kirchliche Arbeit bedeutet.
1. Ergebnisse
1. Die induktiv vorgegangene, theoretische Vorannahmen möglichst vermeidende und für die Gesamtbevölkerung repräsentative Untersuchung kommt hinsichtlich der Religiosität und Säkularität der Bevölkerung in Deutschland zu folgenden religiös-säkularen Orientierungstypen: Kirchlich-Religiöse, Religiös-Distanzierte, Säkulare und Alternative.
2. Die Kirchlich-Religiösen machen 13 % der deutschen Bevölkerung aus (14 % in Westdeutschland, 9 % in Ostdeutschland). Sie zeichnen sich zum einen durch eine kirchlich orientierte Religiosität aus, die für ihre jeweilige Lebenswelt relevant ist. Zum anderen verfügen sie über eine überdurchschnittlich starke gesellschaftliche Integration. Es handelt sich fast durchgehend um Kirchenmitglieder, nur 4 % davon sind Konfessionslose. Ihr Durchschnittsalter ist das höchste von allen Orientierungstypen. Deshalb wird der demografische Wandel zu einem Rückgang des diesem Typus zurechenbaren Bevölkerungsanteils führen. – Bei den Kirchlich-Religiösen kann man als Subtypen unterscheiden: „Religiös-Geschlossene“ und „Religiös-Offene“. Erstere halten an der kirchlichen Tradition fest und grenzen sich von nichtkirchlicher Religiosität ab; Letztere hingegen verbinden beides mit unterschiedlicher Gewichtung.
3. Die Religiös-Distanzierten umfassen 25 % der Bevölkerung (Westdeutschland: 27 %, Ostdeutschland: 13 %). Sie sind überwiegend Kirchenmitglieder, es sind aber auch 16 % Konfessionslose darunter. Bei ihnen überwiegt mit 70 % ein Glaube an Gott, ohne dass sie traditionellen Formulierungen christlicher Lehre zustimmen. Sie haben keine engere Anbindung an kirchliche Strukturen. – Bei den Religiös-Distanzierten kann man als Subtypen unterscheiden: „Distanziert-Kirchliche“, „Distanziert-Alternative“ und „Distanziert-Säkulare“. Distanziert-Kirchliche weisen Elemente einer kirchennahen Religiosität auf, im Unterschied zu den Distanziert-Alternativen, bei denen sich Elemente einer eher kirchenfernen Religiosität zeigen. Die Distanziert-Säkularen stehen der Religiosität überhaupt ferner, sind aber noch auf religiöse Themen ansprechbar.
4. Die Säkularen bilden mit 56 % die Mehrheit der Bevölkerung (Westdeutschland: 53 %, Ostdeutschland: 73 %). Für sie spielt Religiosität in ihrem Leben keine Rolle. 65 % der Säkularen sind konfessionslos, aber auch 35 % der katholischen und 39 % der evangelischen Kirchenmitglieder gehören diesem Typus an. – Bei den Säkularen kann man als Subtypen unterscheiden: „Säkular-Geschlossene“, „Indifferente“ und „Säkular-Offene“. Während Säkular-Geschlossene Religion, Spiritualität und Kirche ablehnend gegenüberstehen, sind die Indifferenten durch Gleichgültigkeit bestimmt. Bei den Säkular-Offenen finden sich neben der auch hier vorherrschenden naturalistischen Prägung auch andere weltanschauliche Versatzstücke, die aber nur selten aus einem kirchennahen Bereich stammen.
5. Die Alternativen schließlich – eine verhältnismäßig kleine Gruppe (6 % der Bevölkerung) – neigen kirchenfernen Religiositätsformen zu. Damit gehen einher geringes gesellschaftliches Engagement, mangelnde Schulbildung und Neigung zum Populismus. – Bei den Alternativen kann man als Subtypen unterscheiden: „Esoterische“ und „Hedonistisch-Heterodoxe“.
6. War man sich kirchlicherseits bereits seit Längerem der verhältnismäßig vielen religiös-distanzierten Kirchenmitglieder bewusst, fällt nun besonders der hohe Anteil von säkular eingestellten Menschen in beiden Kirchen auf.
7. Nahm man noch Ende des letzten Jahrhunderts an, dass zwar die Kirchlichkeit zurückgehe, dafür aber die kirchenferne Religiosität vor allem im Esoterik-Bereich zunehme, zeichnet sich derzeit eine andere Entwicklung ab: Noch stärker als die Kirchlich-Religiösen ist der alternative religiöse Orientierungstyp geschrumpft.
8. Zwei Drittel sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirchenmitglieder teilen ein auf Jesus Christus bezogenes Gottesbild nicht, konnten jedenfalls der Aussage nicht zustimmen: „Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“. Daraus folgt, dass nicht nur die Kirche als Organisation in eine Krise geraten ist, sondern auch der überlieferte christliche Gottesglaube. Unter den Konfessionslosen überwiegt mit 57 % die Auffassung, dass es weder Gott noch irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Die Lösung institutioneller Bindungen zu den beiden früheren Großkirchen und der Verlust eines tradierten Gottesglaubens gehen folglich Hand in Hand. Ein „believing without belonging“ tritt also kaum oder nicht auf.
9. Aufs Ganze gesehen, ist folgende für den Bestand der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland dramatische Entwicklung zu beobachten: Der Bevölkerungsanteil der Kirchlich-Religiösen schrumpft, indem ein Abfluss an die Religiös-Distanzierten stattfindet. Von den Religiös-Distanzierten wiederum geht ein noch größerer Strom an die Säkularen weiter, wo mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit angekommen ist. Dominierten unter den Säkularen früher die Indifferenten, die sich bei Religionsfragen gleichgültig zeigen, gewinnen in neuerer Zeit solche Stimmen an Gewicht, die Religion dezidiert ablehnen. Die religiöse Entfremdung ist offenbar so groß geworden, dass Religion als etwas kulturell Fremdes und damit als eine Bedrohung der eigenen Identität bzw. Freiheit empfunden wird.[2]
10. Während in der gegenwärtigen Religionssoziologie man in der Regel von einer Zunahme von Indifferenz gegenüber religiösen Fragen ausgeht, legt die 6. KMU es nahe, eine Ausbreitung des Säkularismus anzunehmen. Vergleichbare Prozesse der Säkularisierung lassen sich übrigens auch in anderen europäischen Ländern beobachten. Der kirchliche Erosionsprozess vollzieht sich schneller, als noch vor wenigen Jahren angenommen. Insofern fußt etwa ekhn2030 – der Reformprozess der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) – auf zu optimistischen Voraussetzungen.[3] Es gilt also, sich ehrlich zu machen.
Welche Konsequenzen sollten die Kirchen für ihr zukünftiges Handeln aus den Ergebnissen der 6. KMU ziehen?
2. Konsequenzen
1. Kirchliches Handeln darf sich nicht von der Annahme leiten lassen, dass Religiosität eine anthropologische Konstante ist, die nicht zurückgehen könne. So lässt sich bei vielen Menschen kein Bedürfnis nach Gott, Transzendenz oder Spiritualität feststellen; auch ist es fraglich geworden, ob jeder Mensch in seinem Leben nach einem umfassenden Sinn sucht.[4]
2. Die Kirchen dürfen sich über die fundamentale Krise des religiösen Glaubens, der religiösen Praxis, des religiösen Erfahrens und der religiösen Kommunikation nicht hinwegtäuschen.
3. Bloße Strukturänderungen wie etwa die Bildung von sogenannten „Nachbarschaftsräumen“ bieten keinen wirklichen Beitrag zur Lösung dieser Krise. Sie sind allenfalls notwendige Anpassungsmaßnahmen, die durch die zurückgehenden Kirchenmitglieder, das rückläufige kirchliche Finanzaufkommen und den zahlenmäßig nicht ausreichenden theologischen Nachwuchs bedingt sind. Auf großflächige Organisationsformen zu setzen, ist sicher der falsche Weg, um Menschen an die Kirchen zu binden.
4. Der Schwerpunkt kirchlichen Handelns muss in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien liegen. Denn nur wer in jungen Jahren die Relevanz des christlichen Glaubens erfährt, wird sie auch als Erwachsener wertschätzen können. Ausnahmen bestätigen diese Regel.
5. Wenn es immer weniger selbstverständlich ist, einer Kirche anzugehören, dann gilt es vor allem, vonseiten der Kirche den Menschen nahe zu sein und Bindungen zu ermöglichen. Dabei wird es vor allem auf die Gemeinde vor Ort ankommen. Die Kirchenorganisation ist daher möglichst schlank zu halten und auf das unbedingt Nötige zu beschränken. Was nicht der Kirchenbindung dient, kann getrost wegfallen.
6. Da die religiöse Entwicklung innerhalb der Gesellschaft immer mehr hin zu kirchlich-distanzierten und säkularen Haltungen geht, bedarf es einer Theologie, die ihre Botschaft neu durchdenkt und in einer solchen Weise verständlich macht, dass sie als eine Option selbst für einen säkular eingestellten Menschen ernsthaft in Betracht kommt.
7. Es reicht nicht aus, veraltete Formen durch ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild zu ersetzen, vielmehr besteht die Herausforderung darin, sich mit der Entfremdung der Menschen von den traditionellen Glaubensinhalten konstruktiv auseinanderzusetzen.[5] Als Christenmenschen, erst recht als Pfarrerinnen und Pfarrer müssen wir uns und anderen darüber Rechenschaft geben, was wir unter Gott, Jesus, heiligem Geist, Reich Gottes, Gericht, Auferstehung und ewigem Leben verstehen. Dies kann nur in großer Offenheit und Aufgeschlossenheit erfolgen – gemäß der Aufforderung des Apostels Paulus: „Prüfet alles und das Gute behaltet!“ (1Thess 5,21)
8. Mit anderen Worten: Es bedarf einer liberalen Theologie.[6] Eine solche Theologie steht in Spannung zu einer „bibeltreuen Theologie“, für welche die Aussagen der Bibel in ihrem Wortlaut unverrückbarer Maßstab sind, ebenso zu einer „konfessionellen Theologie“, die auf den Dogmen, Bekenntnissen und Katechismen der jeweiligen Kirche basiert und alle theologischen Aussagen daran misst. Eine liberale Theologie hingegen weiß sich in ihrer Besinnung auf das Unbedingte in erster Linie der Wahrheit verpflichtet. „So steht es in der Bibel“ oder „So steht es in unserem Bekenntnis“ kann für sich genommen noch nicht als ausschlaggebendes Argument gelten. Eine liberale Theologie kann nur das anerkennen, was einleuchtet und überzeugt, was also im eigenen Wahrheitsbewusstsein einen Widerhall findet.
9. Kirche muss sich einem offenen Dialog stellen, in dem sie sich hörend und verstehend ihrem jeweiligen Gegenüber zuwendet, ihre Inhalte, Überzeugungen, Werte und Ziele in klaren Worten und mit überzeugenden Argumenten vertritt.
10. Dabei wird es entscheidend auf persönliche Glaubwürdigkeit ankommen. Kirchliches Reden und kirchliches Handeln müssen einander entsprechen. Dabei sind mögliche Fehler und Schuld einzugestehen und dürfen nicht vertuscht werden; ein daraus resultierendes geändertes Verhalten muss deutlich erkennbar werden.
Anmerkungen
[1] Vgl. zum Folgenden: Wie hältst du’s mit der Kirche? Zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft. Erste Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, hg. v. der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Leipzig 2023.
[2] Vgl. Jan Loffeld, Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz, Freiburg i.Br. 2024, S. 38.
[3] Im Jahr 2022 hatte die EKD einen Rückgang von 2,9 % zu verzeichnen, bei einer Austrittsquote von 1,9 % (vgl. epd-Artikel „Bittere Realität“, in: Evangelische Sonntags-Zeitung vom 19.3.2023, S. 6). Damit dürfte die Modellrechnung der Universität Freiburg bereits überholt sein – diese nahm eine jährliche Austrittsquote von 0,95 % an –, auf der der Prozess ekhn2030 basiert. Mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack von der Universität Münster sind die Austrittszahlen Ausdruck einer gesellschaftlichen Säkularisation, die von Generation zu Generation zunehme (vgl. Merle Schmalenbach, Was treibt sie weg? 380.000 Menschen traten 2022 aus der evangelischen Kirche aus, in: Christ & Welt Nr. 12 vom 16.3.2023, S. 2). Dabei handelt es sich um eine fatale Entwicklung, auf die die EKHN, aber auch die evangelische Kirche insgesamt keine überzeugende Antwort hat.
[4] Vgl. J. Loffeld, Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt (s. Anm. 2), S. 46.
[5] Vgl. Markus Beile, Erneuern oder untergehen. Optionen für die Zukunft der Kirche, in: DtPfrBl 124 (2024), S. 355-362.
[6] Die folgenden Sätze in enger Anlehnung an: Andreas Rössler, Denkwege eines freien Christentums, hg. v. Raphael Zager u. Werner Zager, Nordhausen 2020, S. 60.