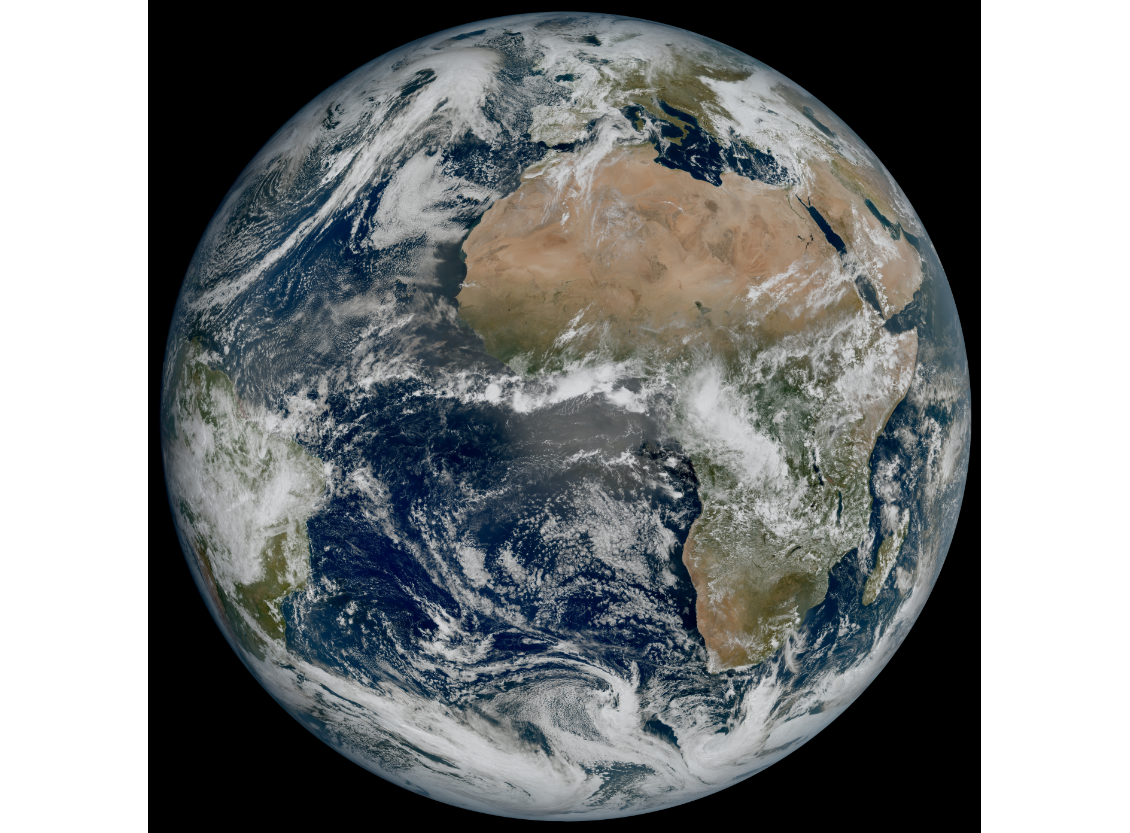Eine Antwort an Claus Petersen auf seinen Beitrag vom 4. April 2024

Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes
Eine Antwort an Claus Petersen
1. Claus Petersen bemängelt, dass ich Mt 28,19 f. („Darum gehet hin und lehret alle Völker … und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe“) als Begründung für den Auftrag der Kirche herangezogen habe, weil doch nicht feststehe, dass dieser Text authentisch von Jesus stamme. Ich selbst hatte seine Authentizität als genuines Jesuswort infrage gestellt. Aber ob authentisch oder nicht: Das ist m.E. überhaupt nicht relevant, denn es ändert nichts an der Tatsache, dass die Kirche schon immer ihren Auftrag u.a. auch von diesem Text her bezogen hat. Und es ist doch – authentisch oder nicht – gar nicht falsch, wenn sich die Kirche auf Jesus bezieht. Das tut ja auch Claus Petersen, und das tue ich auch.
2. Aus meiner bescheidenen Sicht scheint Petersen die Frage, ob gewisse neutestamentliche Texte nun genuin jesuanisch sind oder von der Urgemeinde stammen, überzubewerten. Das war schon der Fehler der liberalen Suche nach dem historischen Jesus, insofern man sich davon erhoffte, den christlichen Glauben auf eine neue (historischere) Grundlage zu stellen. Dieser Versuch gilt aber als gescheitert. In der Tat ist vieles von dem, was in den Evangelien berichtet wird, nur bedingt als jesuanisch anzusehen. Ich halte es aber generell für fehlgeleitet, nur solche Texte als relevant für unseren Glauben zu deklarieren, die nachweislich auf Jesus zurückzuführen sind. Von diesem Fehler wollte uns schon Rudolf Bultmann bewahren. Zurecht! Das heißt aber: Auch solche Texte, die (nachweislich oder vermutlich) als spätere urgemeindliche Ausschmückungen oder Deutungen zu werten sind, können Relevanz für unseren Glauben haben. Sie sind ja zumindest indirekt von Jesus inspiriert. Am Ende meines Beitrags schreibe ich deshalb: „Gegenstand der kirchlichen Botschaft muss das Evangelium von Jesus Christus in seiner biblischen Bezeugung sein.“ Dass man dabei jeweils die Frage nach der Authentizität neutestamentlicher Texte stellen darf, bleibt davon unberührt. Es gilt aber, die ganze Bibel ernst zu nehmen.
3. Petersen scheint ferner zu kritisieren, dass ich mich bei meinen Ausführungen auf die Predigten, Gleichnisse und Heilsberichte Jesu berufe. Aber auf was soll man sich denn sonst berufen, wenn nicht auf diese, wenn man Jesus ernst nehmen möchte? Auch wenn wir manches überlieferte Wort und manches Gleichnis Jesu mit Vorbehalten versehen, können diese dennoch Grundlage unserer Verkündigung sein! Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass sich das, was ich über die Verkündigung Jesu und die Gleichnisse Jesu geschrieben habe, auf Berichte stützt, die tatsächlich auf Jesus zurückgeführt werden können. Dass Jesus etwa häufig vom „Reich Gottes“ gesprochen hat und er das „Reich Gottes“ anschaulich durch seine Gleichnisse gedeutet hat, wird heute kein ernsthafter Theologe infrage stellen. Und meist ging es bei diesen jesuanischen Äußerungen um die Art und Weise, wie wir leben sollen und wie wir uns andern gegenüber verhalten sollten.
4. Wie sieht es nun aber mit Jesu angeblichen Heilstaten aus? Petersen ist der Meinung, Jesus habe „keine Heilungen vorgenommen“. Tatsache ist, dass von Jesus zahlreiche Heilungen berichtet werden. Gleichzeitig wird aber auch berichtet, er habe sich geweigert, Forderungen nach Wundern zu erfüllen; man solle vielmehr seinem Wort glauben, nicht irgendwelchen Wundern, gab Jesus zu verstehen (vgl. Mk 8,12). Auch ich gehe davon aus, dass die Heilungsberichte maßlos übertrieben sind, dass die meisten „Wunder“ sich nicht genauso abgespielt haben, wie sie berichtet werden. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass diese Berichte nicht entstanden wären, hätten Menschen nicht an sich selbst wundersame Veränderungen und heilende Erlebnisse erfahren. Man könnte davon ausgehen, dass Jesus so etwas wie eine traditionelle Medizin praktizierte und er durch seine menschliche Zuwendung auch die Selbstheilungskräfte der Menschen aktiviert hat, so wie dies Medizinmänner, Schamanen und andere Geistheiler immer schon getan haben und heute noch tun. Und wo es zu solchen Heilungen gekommen sein mag, hat Jesus diese offenbar nicht sich selbst zugeschrieben, sondern der Kraft (dem Finger, dem Geist) Gottes, der in diesen geheilten Menschen wirksam wurde. Und: er hat solche Heilungen offenbar als ein Hereinbrechen des Reiches Gottes angesehen (vgl. Lk 11,20).
5. Obwohl Jesus das „Reich Gottes“ in seinen Erzählungen und Gleichnissen vielfach veranschaulichte, hat er es nirgends genau definiert. Warum nicht? Er brauchte es nicht, denn die Menschen, zu denen er sprach, hatten eine Vorstellung von dem, was zu ihrer Zeit unter „Reich Gottes“ verstanden wurde. Viele erwarteten (oder wünschten), dass es bald einen befreiten, unabhängigen jüdischen Staat geben würde, in dem die Mosaischen Gesetze wieder gelten würden und in dem allgemeine Gerechtigkeit geübt werde. Manche Zeitgenossen, die etwas pessimistischer waren, befürchteten vielleicht, dass dieses „Reich Gottes“ noch eine gute Weile auf sich warten lassen würde und haben es für eine unbestimmte, fernere Zukunft erwartet; und wieder andere vermuteten wohl, dass Gott erst am Ende der Zeiten bei einem Weltgericht ein solches Reich durch sein eschatologisches bzw. apokalyptisches Eingreifen herstellen würde.
6. Jesus hat solchen zeitgenössischen Erwartungen (die auch von Johannes dem Täufer geteilt wurden) widersprochen und die Meinung vertreten, dass das Reich Gottes nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag warten müsse, sondern bereits hier und jetzt beginnen kann. Darin sind sich Claus Petersen und ich ja denn auch völlig einig. Wenn Jesus beispielsweise sagte: „Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen“ (Lk 11,20), so meinte er, dass an diesen punktuellen Stellen, wo Heilung erfahren wird, das Gottesreich aufscheint.
7. Nun hat Petersen gerade bei Lk 11,20 (bzw. Mt 12,28) dieses „Dämonenaustreiben“ so gedeutet, dass es hier angeblich um „die Dämonen des Reich-sein-Wollens“ gehe. Das halte ich für eine Fehldeutung. Zwar war es in der Tat ein wichtiges Anliegen Jesu, das Unverhältnis von reich und arm immer wieder anzuprangern, aber bei Lk 11,20 darf man den Kontext nicht außer acht lassen. Laut dem Bericht hatte ein zuvor Stummer wieder zu reden begonnen. Bei der Parallelstelle Mt 12,28 war es sogar ein Taubblinder, der auf einmal sprechen und sehen konnte. Vielleicht ist diese Geschichte ja gänzlich erfunden. Vielleicht hat sie aber auch einen historischen Kern. Ich persönlich glaube nicht, dass Jesus einen Taubblinden zum Sehen und Sprechen gebracht hat (das wäre m.E. schlichtweg unmöglich; Begründung kann nachgeliefert werden). Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er einen traumatisierten Menschen, der aufgrund seiner Traumatisierung verstummt war, wieder zum Sprechen brachte. Und wenn ja, dann ist das eben ein Hereinbrechen des Reiches Gottes. Wenn traumatisierte Menschen heute geheilt werden und wieder ein normales Leben leben können, ist das ein Stück „Reich Gottes“ (jedenfalls in der Sprache Kanaans).
8. Es gibt übrigens in manchen Ländern der Welt heute immer noch Taube, Blinde und Taubblinde, die verschämt in der hintersten Ecke der Hütte gehalten werden und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Wenn aber heutzutage sogar Taubblinde durch das Lormen und durch Bildung und Rehabilitation lernen, am allgemeinen Leben teilzunehmen (wie etwa Helen Keller das konnte), so mag das als ein Aufscheinen des Reiches Gottes gedeutet werden. Und woimmer die Kluft zwischen reich und arm verringert oder ganz aufgehoben wird, da entfaltet sich – in der Sprache Jesu – das Reich Gottes. Die krasse Kluft zwischen den Reichen und den Armen ist ein Symptom des „Reiches dieser Welt“, dem Jesus die Prinzipien des „Reiches Gottes“ entgegenstellte.
9. Claus Petersen vermutet, ich könnte mir solche Texte ausgesucht haben, die sich am besten mit meiner Sicht vereinbaren lassen. Diesen Vorwurf kann ich nicht ganz von der Hand weisen. Aber das haben vor mir schon viele andere getan, und auch Petersen tut es genauso. Trotzdem glaube ich gute Gründe (und biblische Texte) für meine Darstellung zu haben, und diese habe ich erläutert. Und so glauben wir beide, dass wir uns „mit einigem Recht“ (wie Petersen schreibt) auf das ursprüngliche Evangelium berufen.
10. Petersen kritisiert in seiner Replik den oft erhobenen Anspruch, Jesus sei als übermenschlich, als göttlich, als Gottessohn verstanden worden. Diese Kritik teile ich uneingeschränkt. Jesus ist unser Bruder. Er war ganz und gar Mensch. Die Vergöttlichung Jesu samt seiner Präexistenz und seiner Postexistenz ist metaphorisch oder mythologisch zu verstehen. Da gibt es keinen Dissens.
11. Über Petersens Einschätzung, Jesu Botschaft sei frei von Apokalyptik und Eschatologie gewesen, habe ich mich gefreut. Damit widerspricht er zwar großen Teilen der deutschen Theologie (hier hatte Johannes Weiß eine fatale Weichenstellung vorgenommen!); aber auch ich bin der Meinung, dass die eschatologische Erwartung (die es bei Jesus durchaus gegeben haben mag) oft überbewertet wurde und immer noch wird. Jesus hat dieser Vertröstung in die Zukunft ja gerade seine präsentische Dimension des Reiches Gottes entgegengestellt. Also auch hier besteht weitgehende Einigkeit zwischen Petersen und mir.
12. Claus Petersen deutet das Reich Gottes als einen Zustand, in dem wir glücklich, selig und zufrieden sind, und zwar im Hier und Jetzt. Ja, da stimme ich weitgehend zu. Wenn wir einen solchen Zustand erfahren und empfinden, dann erleben wir „Reich Gottes“. Aber was ist mit den unzähligen Hungernden, Verfolgten, Verstümmelten, zu unrecht Eingekerkerten, den sträflich Vernachlässigten, den Heimatlosen, den absolut Armen, die in ständiger Sorge um ihr Überleben sind? Da müssen wir doch erkennen, dass das Reich Gottes zwar hier und da bereits angebrochen sein mag, aber eben noch nicht in seiner ganzen Fülle sich entfaltet hat. Das Reich Gottes, was immer wir davon erfahren oder in die Wirklichkeit zu bringen in der Lage sein mögen, beinhaltet stets einen eschatologischen Vorbehalt, einen Verheißungsüberschuss. Gerade wenn wir uns die Kluft zwischen den Reichen dieser Welt und den Armen und Hungernden ansehen, müssen wir erkennen, dass das Reich Gottes für viele Menschen noch nicht gekommen ist. Da liegen offenbar große Herausforderungen vor uns, die wir nicht ignorieren können. Sollen wir sie einer eschatologischen Zukunft überlassen? Oder gilt es, optimistisch und aktiv anzupacken und an Gottes Wirksamkeit in dieser Welt zu glauben?
Kurt Bangert