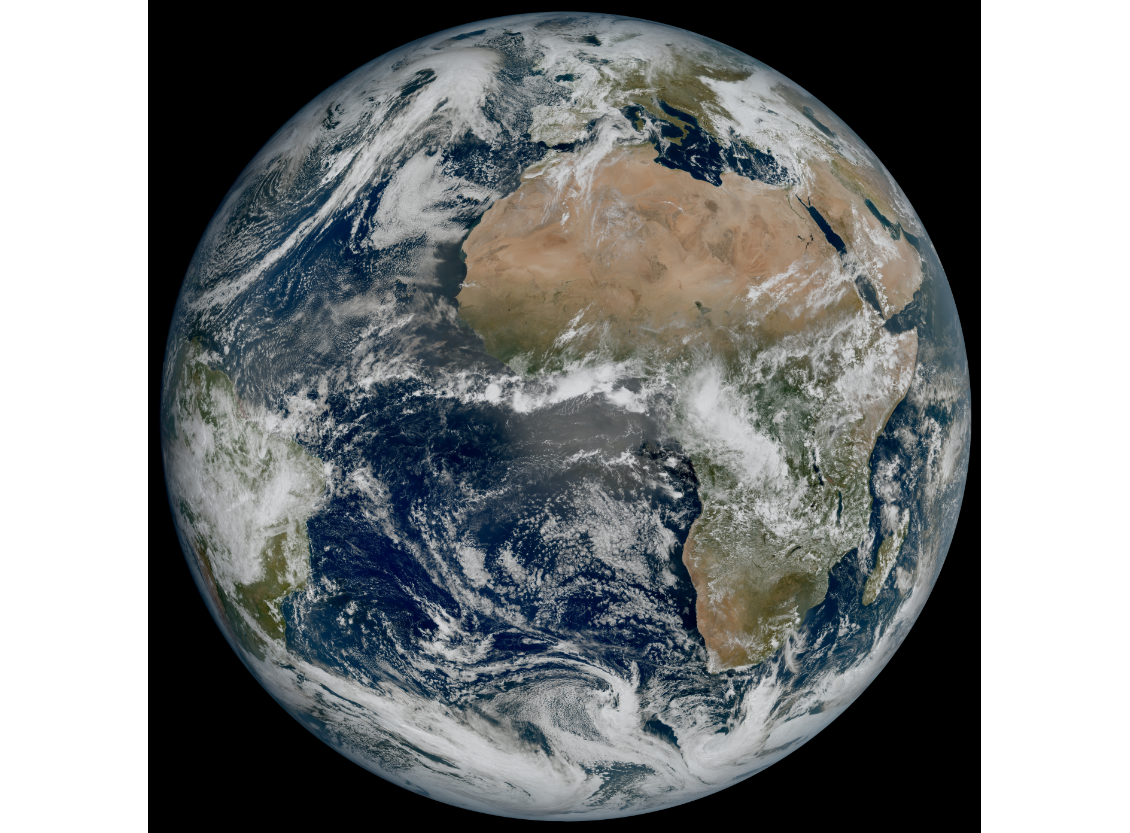Anmerkungen zum Beitrag „Die Aufgaben der Kirche“ von Kurt Bangert,
insbesondere zu seinen Ausführungen über die Botschaft und Praxis Jesu
Du bist bereits in Vorleistung gegangen, lieber Kurt, hast „die Aufgaben der Kirche“ beschrieben und am Schluss konkret benannt, die sich ergäben, wenn die im Göttinger Manifest 2024 skizzierte fundamentale Krise der Kirchen endlich ernst genommen und daraus Konsequenzen gezogen würden. Und dabei möchtest du der fundamentalen Neuorientierung entsprechen, die unser Manifest vornimmt, nämlich dass es die Orientierung an der Reich-Gottes-Botschaft und der Reich-Gottes-Praxis Jesu von Nazaret ist, die das Spezifikum des Christentums ausmacht. Du formuliert es klipp und klar: Es gilt, „das eigentliche, ursprüngliche Evangelium, wie Jesus es zu seiner Zeit predigte, immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. Dieses ursprüngliche Evangelium zu bezeugen, ist (…) die erste und vorrangige Aufgabe der Kirche.“ (Kapitel Martyria, letzter Absatz)
Nur: Wie lässt sich das jesuanische Evangelium ermitteln, an dem sich die Kirche zu orientieren hätte? Du gehst von dem sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28,19f. aus, den du gleich zu Beginn zitierst. Von diesem „Auftrag ihres Herrn Jesus Christus“ leite die Kirche ihre Existenzberechtigung ab. Nur müsste er dann auch tatsächlich – wörtlich oder zumindest sinngemäß – auf Jesus zurückgehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es ist nicht nur „nicht strikt nachzuweisen, ob dieser Bibelvers auch wirklich von Jesus stammt“, vielmehr ist dies strikt auszuschließen, da ist sich die neutestamentliche Exegese einig.
Und dies gilt nicht nur für diesen Vers. Zwar stehen uns zur Beantwortung der Frage nach dem „eigentliche(n), ursprüngliche(n) Evangelium, wie Jesus es zu seiner Zeit predigte“, nur die ersten drei Evangelien des Neuen Testaments zur Verfügung. Doch sind nicht nur alle übrigen Schriften des Neuen Testaments, sondern schon das älteste biblische Evangelium, das des Markus, an dieser Frage gar nicht mehr interessiert. Markus will nicht etwa zum Glauben an das Evangelium Jesu aufrufen, sondern zum Glauben an Jesus selbst, und zwar an ihn als den Christus und Gottessohn. „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes“, heißt es gleich im ersten Satz. Das ist sein Thema, das er im Folgenden entfaltet: Unmittelbar nach Jesu Taufe, „geschieht aus dem Himmel die (göttliche) Stimme: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen“ (Markus 1,11); in der Mitte stehen das Bekenntnis des Petrus: „Du bist der Christus“ (8,29) und die (göttliche) Stimme aus der Wolke: „Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören” (9,7); und am Ende, unmittelbar nach Jesu Tod, bekennt der Hauptmann am Kreuz: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ (15,39) In all diesen Fällen handelt es sich nicht um historische Erinnerungen, vielmehr bringt der Verfasser an den markantesten Stellen seines Evangeliums zum Ausdruck, wer der Jesus, von dem es handelt, in seinen Augen beziehungsweise nach dem Verständnis seiner Gemeinde in Wahrheit gewesen ist und wen seine Leser in ihm „sehen“ sollen.
Aber das ist noch längst nicht alles. David Friedrich Strauß hat in seinem bahnbrechenden, im Jahr 1835 erschienenen Werk „Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet“ die Traditionen der Evangelien mit äußerster Akribie verglichen und analysiert und ist dabei zu dem kaum zu widerlegenden Urteil gelangt, dass sämtliche Wundererzählungen keinerlei historische Grundlagen haben[1]. Es handelt sich um Legenden (bzw. Mythen, wie er sie nennt), die aufzeigen wollen, dass Jesus tatsächlich der Christus, der mit völlig außergewöhnlichen, auch alttestamentliche Wundertäter weit in den Schatten stellenden Fähigkeiten ausgestattete Messias gewesen ist. Der historische Jesus hat keine Heilungen vorgenommen (jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn) oder sonstige Wundertaten vollbracht[2]. Das gilt auch für die Dämonenaustreibungen (Exorzismen); ich komme noch darauf zu sprechen. Doch damit nicht genug. Zu all diesen christologischen Legenden gehören nicht nur unter vielen anderen die Erzählungen von der Geburt Jesu und ihren Begleitumständen sowie seiner Kindheit, sondern auch diejenigen von seiner Auferstehung und Himmelfahrt.
Die entscheidende Frage lautet also jetzt: Können wir, zumindest in den ersten drei Evangelien, überhaupt noch Spuren dessen finden, was die Botschaft und das Leben Jesu, des wirklichen, lebendigen Jesus von Nazaret, eben des historischen Jesus, ausgemacht hat? Dein Ansatz, Kurt, wird dem geschilderten Sachverhalt nicht gerecht. Um die „inhaltlichen Schwerpunkte“ des jesuanischen Evangeliums zu benennen, „das die Kirchen noch heute zum zentralen Inhalt ihrer Verkündigung machen sollten“, legst du „die von Jesus verkündigten Predigten und Erzählungen (Gleichnisse) und die von ihm berichteten Heilstaten“ zugrunde, also prinzipiell alle, die ihm die neutestamentlichen Evangelien zuschreiben (Martyria, 2. Absatz). Du führst keinerlei Gründe an, die den jesuanischen Ursprung der betreffenden Überlieferung zumindest nahelegen.
Wie aber gehen wir vor, um dem Verdacht vorzubeugen (ich kann dich, lieber Kurt, leider nicht davon freisprechen), uns aus jenen Texten diejenigen herauszusuchen, die sich mit unserer momentanen eigenen Sicht am besten vereinbaren lassen? Ich räume sofort ein: Das, was sich mir nach intensiver, jahrzehntelanger exegetischer Arbeit erschlossen hat, erweist sich – jeden Tag, möchte ich fast sagen – als für mein Leben, für meine Daseinshaltung als ungemein wertvoll, als das Schönste, Beste und Wichtigste überhaupt. Es ist die Quelle meiner Lebensfreude. Gleichwohl meine ich, mich dabei mit jedenfalls einigem Recht auf „das eigentliche, ursprüngliche Evangelium, wie Jesus es zu seiner Zeit predigte“, berufen zu dürfen. Und ich glaube, dass man sich meiner „Beweisführung“ nicht so ohne Weiteres entziehen kann.
Jedenfalls geht es nicht an, von vornherein die Möglichkeit auszuschließen, angesichts der Tatsache, dass die Evangelien – unbestreitbar – in überwältigender, geradezu verstörender Weise aus Legenden und Worten bestehen, die Jesus mit Sicherheit erst nachträglich in den Mund gelegt worden sind, gleichwohl Überlieferungen zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf Jesus selbst zurückgehen. Meines Erachtens lassen sich – und zwar ebenfalls auf der Grundlage der neutestamentlichen Überlieferung – durchaus Kriterien benennen, die nicht nur die Konturen des jesuanischen Evangeliums andeuten, sondern seine Grundstruktur in aller Deutlichkeit erkennbar machen. Vielleicht kannst auch du, lieber Kurt, meinem Vorschlag etwas abgewinnen – oder er überzeugt dich sogar.
Ich setze bei der Feststellung an, dass die Behauptung Martin Luthers, „dass es nicht mehr als ein Evangelium gibt“, nämlich die „Predigt von Christus, Gottes und Davids Sohn, wahrem Gott und Mensch, der für uns mit seinem Sterben und Auferstehen aller Menschen Sünde, Tod und Hölle überwunden hat, die an ihn glauben“, wie er in seiner „Vorrede auf das Neue Testament“ von 1522 behauptet, nicht zutrifft. Sicher gilt dies für die Briefe des Paulus, und auch die Evangelien präsentieren, wie wir ja gesehen haben, Jesus als den Christus und Gottessohn. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth „an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe (...), dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas..." (1. Korinther 15,1ff.), Markus geht es um das „Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.“ Aber wenig später lesen wir bei ihm Worte, die das, was das Evangelium ausmacht, völlig anders verstehen. Hier bezieht sich dieser Begriff nämlich nicht auf die Person Jesu, sondern auf seine Botschaft. Markus stellt diese Sätze zwar nicht an den Anfang seines Evangeliums, konnte sie aber offensichtlich noch nicht völlig ignorieren. Doch auch hier, wenn auch erst im 15. Vers des ersten Kapitels, sind sie durchaus von erheblichem Gewicht: In seinem Evangelium sind es die ersten Worte Jesu. Sie klingen wie eine Zusammenfassung seiner Botschaft. Es ist ein Hymnus, nicht Prosa, sondern Poesie, sie heben an wie ein Fanfarenstoß. Am Anfang stehen – ungewöhnlich, aber natürlich voll beabsichtigt – die beiden entscheidenden Verben: „Erfüllt ist die Zeit, / gekommen ist das Reich Gottes. / Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ Das also ist hier das Evangelium: Das Reich Gottes ist nicht mehr, wie man bisher angenommen hat, Erwartung, Hoffnung, Zukunft, sondern es ist Gegenwart. Das ist die frohe Botschaft. Es steht nicht mehr aus. Es ist da. Das ist wahrhaftig ein völlig neuer Ton.
Allerdings: Aus sprachlichen und auch inhaltlichen Gründen dürfte allerdings auch hier kein „echtes Jesuswort“ vorliegen. Vermutlich geht es auf Menschen zurück, die nach Jesu Tod sein Evangelium, seine Sache weitergetragen haben – und die hätte es demnach immerhin gegeben! Wir müssen jetzt also prüfen, ob sich in den neutestamentlichen Evangelien, die, wie gesagt, das Evangelium ganz anders verstehen, gleichwohl Worte aufspüren lassen, die jene Proklamation in Markus 1,15 bestätigen. Sollte das der Fall sein, hätten wir das jesuanische Evangelium, sozusagen unter dem Boden des Neuen Testaments, doch noch aufgespürt!
Und tatsächlich: Wir werden fündig. Jesus verkündigte – in diametralem Gegensatz zu seinem einstigen Lehrer Johannes dem Täufer – die Gegenwart des Reiches Gottes. „Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch!“, heißt es klar und eindeutig in Lukas 17,21. Mit den Worten „Kommt, denn es ist schon bereit!“ lädt der Diener im Gleichnis in Lukas 14 zum „großen Festmahl“ ein – ganz bestimmt ein Bild für das Reich Gottes. Den Kindern spricht Jesus das Reich Gottes vorbehaltlos zu: „solcher ist das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kommt nicht hinein.“ (Markus 10,14b–15) Das aber, hineinkommen in das Reich Gottes, an ihm teilhaben, das sollen wir Menschen – und zwar hier und jetzt. Damit kann in diesem Fall nur das spezifische Verhältnis zur Welt gemeint sein, das Kinder gleichsam mitbringen und sich dementsprechend verhalten, uns Erwachsenen aber weithin verloren gegangen ist. Anders als wir können sie die Welt noch nicht als Objekt betrachten, aus der Distanz heraus, von außen, mit all den fatalen Folgen, sondern sie kooperieren und kommunizieren ganz selbstverständlich mit ihr. „Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.“ (Markus 10,25) Den Reichen spricht Jesus die Teilhabe am Reich Gottes kategorisch ab, sie haben keinen Anteil daran, denen aber, die nicht reich sind, den Armen, denen also, die nicht mehr haben, als sie brauchen, spricht er es unmittelbar zu: „Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes“ (Matthäus 5,3/Lukas 6,20b) – weil sie richtig leben, im Einklang mit ihrer Mitwelt, der sie immer nur das Nötige entnehmen, und genau deshalb glücklich, ja „selig“ sind. Nicht also, weil sie sich nicht mit dem Genug begnügen, sondern weil sie das Genug genießen. Nur das Genug ermöglicht diesen Lebensgenuss, nicht, selbstredend, ein Zuwenig, auf gar keinen Fall aber auch jedes Zuviel.
Es ist dieser Lebensgenuss, diese wirkliche Daseinsfreude, auf die es Jesus ankommt. „In seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt, und kauft jenen Acker“, heißt es in seinem Reich-Gottes-Gleichnis von der Entdeckung des Schatzes im Acker (Matthäus 13,44). Weil er diesen Schatz entdeckt hat, nämlich dass man hier und jetzt am Reich Gottes teilhaben kann, stellt dieser Mensch sein Leben völlig um. Alles, was jener Teilhabe entgegensteht, so mächtig es auch sei, ist überwindbar. „Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann hat euch ja das Reich Gottes erreicht.“ (Matthäus 12,28/Lukas 11,20). Und genau das ist Jesu Intention. Mit den Dämonen meint er nicht irgendwelche „bösen Geister“ oder Symptome psychischer Erkrankungen, sondern die Dämonen des Reich-sein-Wollens, den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt, der aber durchbrochen werden kann und soll, zum Beispiel indem man dem Gewalttäter „die andere Wange hinhält“ (Matthäus 5,39b/Lukas 6,29a), oder das „Besessensein“ von dem der Seligkeit, dem wahren Lebensgenuss vollkommen abträglichen Groß-sein-, Erster-sein-Wollen, dieser Leistungs- und Karriereorientierung. „Wer groß sein will bei euch, der soll euer Diener sein, / und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein.“ (Markus 10,43b–44) Auch in diesem Jesuswort geht es um das Jetzt und Hier, um das richtige Leben. Was bringt es denn, möglichst oben zu stehen, möglichst zu den winnern zu gehören? In Wahrheit zerstört es unser Leben und Zusammenleben. Es ist destruktiv, weil man sich damit von allen anderen Menschen absetzt und abtrennt, was uns überhaupt nicht „liegt“. Ganz anders, beseligend im wahrsten Sinn aber ist es, anderen zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen. Da wächst man über sich hinaus.
Nun wäre es allerdings geradezu abwegig anzunehmen, Jesus meinte mit dem Miteinander und Füreinander als Reich-Gottes-gemäßen Verhaltensweisen zwar grundsätzlich alle Menschen um ihn her, nur nicht sich selbst, da er ja nun einmal, als Messias, als Christus, eine exklusive Sonderstellung einnimmt, also prinzipiell über den Menschen steht. Genau darin aber besteht das eigentliche Problem der so überaus zahlreichen christologisch motivierten Legenden: Sie haben nicht nicht nur keinen Anhalt an der historischen Wirklichkeit, sondern vermitteln ein völlig falsches Jesusbild. Immer erscheint er als eine außergewöhnliche, übermenschliche, geradezu göttliche Gestalt, eben als Christus und Gottessohn. Das ist ja das Anliegen der Evangelisten. Doch mit diesem Wort vom Dienen, vom Füreinander-da-Sein, entzieht Jesus selbst der Christologie, also der Lehre, „Gottes eingeborener Sohn, unser Herr“ zu sein, an den es zu glauben gelte, den Boden. Vielmehr ist er unser Bruder. Seine Worte werden nur dann zu uns sprechen, wenn wir sie als Worte eines solchen hören, wenn sie uns auf der Ebene der Geschwisterlichkeit erreichen, als Worte „von Mensch zu Mensch“ und nicht „von oben herab“.
Diesem so überaus mächtigen christologischen Überbau sind natürlich auch die Jesusworte ausgesetzt. Manchmal verfälscht dieser Überbau die Aussageabsicht dieser Worte – oder sie geraten sogar ganz unter die Räder. Ein Beispiel: „Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat“, heißt es in Markus 2,27. Gut tun soll er den Menschen, ein Tag der Freude soll er sein und keine Last. Jesus reklamiert auch diesen Feiertag für das Reich Gottes. Auf das Wort Jesu folgt im Markusevangelium der Satz: „So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.“ Als ob dies seine Intention gewesen wäre. Jesus unterwirft hier scheinbar selbst sein Reich-Gottes-Wort der Christologie. Matthäus und Lukas, die das Markusevangelium als Quelle für ihre eigenen Evangelien herangezogen haben, übergehen das Jesuswort bereits ganz und übernehmen lediglich jenen christologischen Zusatz (Matthäus 12,8/Lukas 6,5).
Überhaupt ist unverkennbar (und durchaus verständlich), welche Probleme die Evangelisten mit so gut wie allen Jesusworten hatten[3] (ein starkes Indiz allerdings für deren Authentizität!). Oft konnten oder wollten sie es zumindest nicht unkommentiert stehen lassen. So wird die Unvereinbarkeit des Reichseins mit der Teilhabe am Reich Gottes in dem Jesuswort vom Kamel und dem Nadelöhr sofort wieder in Frage gestellt: „Wer kann dann gerettet werden?“, fragen sich jetzt angeblich die Jünger, worauf Jesus der vielzitierte Satz in den Mund gelegt wird: „Bei den Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott“ (Markus 4,27), womit er gleichsam selbst seine klare Aussage wieder zurücknimmt. An die Seligpreisung der Armen hängt man schon bald die Seligpreisungen der Hungernden und Weinenden an, denen eine Umkehrung ihrer Situation in der Zukunft verheißen wird, was dazu geführt hat, dass bis heute nicht nur die Armut in der jesuanischen Seligpreisung ebenfalls negativ als Elend missverstanden und die eindeutig präsentische Zusage des Reiches Gottes einfach in eine futurische umgebogen wird. Die für die Teilhabe am Reich Gottes so wichtige Mahnung, nicht „groß“, nicht „Erster“ sein zu wollen, sondern stattdessen füreinander da zu sein, wird sogleich von dem anschließenden, keinesfalls jesuanischen, aber wiederum ihm als dem „Menschensohn“ zugeschriebenen Satz in den Schatten gestellt (in der Lutherbibel fett gedruckt), dass er „nicht gekommen“ sei, „dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele“. Schlussendlich geht es nicht mehr um das Reich Gottes, sondern um die Person Jesu als den Retter und Erlöser, der seinen bereits vorausgesehenen Sühnetod am Kreuz als den letztlich einzigen Sinn seines Lebens versteht. Auch die Sühnetheologie als wesentliche Funktion der Christologie, die Vorstellung, dass sein Kreuzestod ein Heilsgeschehen war, geht mitnichten auf Jesus zurück. Gleiches gilt für die Einsetzungsworte[4]. Vielleicht stammen sie von Paulus, der glatt behauptet, sie unmittelbar „vom Herrn empfangen“ zu haben (1. Korinther 11,23b–26).
Und noch ein weiteres Paradebeispiel für den Umgang mit der Jesustradition. Vermutlich auf die Frage, warum er und seine Leute nicht fasten, antwortet Jesus: „Wer Hochzeit feiert, kann doch nicht fasten.“ (Markus 2,19) Jesus gleichsam in den Mund fallend, schob man noch vor dem letzten Wort die Worte ein: „solange der Bräutigam bei ihnen ist“. Und diese Einschränkung wird dann noch einmal ausdrücklich wiederholt: „Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten“. Und angeblich stellt Jesus dann schließlich auch noch fest: „Es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen genommen sein wird; dann werden sie fasten, an jenem Tag.“ Damit begrenzte man – und wiederum in Jesu Namen! – das Jesuswort auf die Lebenszeit des „Bräutigams“ (ein weiterer christologischer Hoheitstitel), schloss es damit in eine – aus der Warte der nachjesuanischen Verfasser dieser Zusätze – vergangene Epoche ein und schnitt es von der Gegenwart kategorisch ab.
Jesus aber hat nicht gefastet, vielmehr die Teilhabe am Reich Gottes mit einem Hochzeitsfest verglichen. Dorothee Sölle hielt ihn „für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat“[5] (wenn der Superlativ auch sicher nicht in seinem Sinne ist). Hier und jetzt können wir am Reich Gottes teilhaben, und zwar voll und ganz.[6] Jesus bezieht den Reich-Gottes-Begriff – erstmals – voll und ganz auf das Hier und Jetzt. Seine Botschaft ist frei von jeder Apokalyptik beziehungsweise Eschatologie. Entsprechende Texte – etwa einzelne Gleichnisse oder die sogenannte kleine Apokalypse in Markus 13 – können nicht aus seinem Mund stammen, ebenso wenig die Vaterunserbitte „Dein Reich komme“. Es gibt nichts mehr zu erwarten, zu erhoffen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es steht uns offen. Wir können es leben. Was sollte noch kommen?[7].
Selig, glückselig sollen wir sein, hier und jetzt. Ein Fest soll unser Leben sein, es zumindest immer wieder werden. Es geht um unseren Lebensgenuss! Der aber wird uns nur dann zuteil – wir wissen es im Grunde, müssen aber immer wieder daran erinnert werden und brauchen deshalb die Reich-Gottes-Religion, diese „Welt-Religion“ Jesu –, wenn wir gerade nicht nur an uns selbst denken, uns abschließen und abzusichern versuchen gegenüber den Menschen und der Welt, sondern ganz im Gegenteil: wenn wir zusammen mit ihnen und ihr existieren. Wenn die „Dämonen“ vertrieben sind, wenn wir also gar nicht mehr besitzen wollen, als wir brauchen, weil wir nämlich nur dann unser Leben wirklich genießen können, und uns dafür einsetzen, dass jeder Mensch auf dieser Erde über dieses zum Leben Nötige, und zwar bedingungslos, sicher verfügt[8] – dann wird damit dem Kapitalismus, der unsere Welt in den Abgrund zu reißen droht, der Boden entzogen! Wenn wir nicht mehr ganz oben stehen, nicht mehr immer nur gewinnen wollen, und spüren, dass es uns dabei viel besser geht, werden wir uns der Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft niemals wieder unterordnen und anpassen! Wenn wir mit der Erde leben und nicht mehr auf ihre Kosten, wenn wir mit jedem Bissen Brot, mit jedem Schluck Wasser, mit jedem Atemzug unsere Weltverbundenheit realisieren, ja feiern, was kann uns je wieder davon abbringen? Jetzt nehmen wir alle Menschen als unsere Geschwister wahr und die ganze Welt als Quelle unserer Freude. Und eben dieser Beziehung, dieser Verbundenheit, die sich ganz konkret in der Art und Weise äußert, wie wir leben, in unserem Lebensstil, diesem Zusammenhang, in dem wir jetzt existieren, verleiht Jesus den Hoheitstitel „Reich Gottes“. Es gibt nichts Größeres. Das ist sie, das ist die Botschaft für unsere Welt![9]
Unsere Aufgabe wäre jetzt, Erfahrungsräume für eine solche Existenzweise zu schaffen, Gelegenheiten, ihre Grundstrukturen wahrzunehmen und zu realisieren. Für Jesus haben dabei die Tischgemeinschaften eine wichtige Rolle gespielt. Er vergleicht das Reich Gottes nicht nur mit einem großen Gastmahl, sondern hat dieses „Hochzeitsfest“, wiederum seinen eigenen Worten zufolge, auch selbst begangen. Einen „Fresser und Weinsäufer“ (Matthäus 11,19/Lukas 7,34) haben ihn die genannt, die es (noch) nicht verstehen konnten, dass ein homo religiosus wie Jesus mit dem Genießen von Speise und Trank seiner Botschaft Ausdruck verlieh. Hier wird das Reich Gottes gelebt und erfahren: Alle haben einen Platz, alle sitzen an einem Tisch, alle sind in gleicher Weise versorgt mit dem, was sie brauchen. Ich habe einmal zusammen mit Klaus-Dieter Höflich, der auch unserem Netzwerk angehört, in seiner Stuttgarter Gemeinde eine „Feier der Weltverbundenheit“ gestaltet, darin integriert ein gemeinsames Mittagessen. Vielleicht wäre so etwas ein Ansatzpunkt, um Menschen heute wieder an die Sache Jesu heranzuführen und sie zugleich erfahrbar zu machen. Das Leben soll wieder Freude machen und Sinn. Die Teilhabe am Reich Gottes erfahrbar zu machen, das wäre die Aufgabe der Kirche – und entspräche es letztlich nicht auch deiner hochrespektablen Intention, lieber Kurt? Lass uns im Gespräch bleiben!
[1] Man kann dies im Internet nachprüfen. Beide Bände sind hier einsehbar, und zwar unter
https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/strauss_jesus01_1835 (Band 1) und
https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/strauss_jesus02_1836 (Band 2).
[2] Du gehst sogar so weit zu behaupten, Jesu Botschaft für den Einzelnen habe unter anderem gelautet: „Du kannst psychisch und körperlich gesund werden, wenn du nur glaubst und die Kraft Gottes für dein Leben in Anspruch nimmst.“ (Martyria, 5. Absatz) – eine sehr gefährliche These, finde ich, und zudem unzutreffend.
[3] Es können hier nicht alle 21 Worte aufgeführt werden, die meines Erachtens mit großer Wahrscheinlichkeit auf Jesus von Nazaret zurückgehen. Ich verweise dazu auf den „Basiskurs Basileiologie“ auf der Website der Ökumenischen Initiative Klartext Jesus: https://www.klartext-jesus.de/basileiologie/. Der Terminus Basileiologie (die „Lehre vom Reich Gottes“) leitet sich ab vom dem griechisch-neutestamentlichen βασιλεία τοῦ θεοῦ, basileía toũ theoũ, „Reich Gottes“.
[4] „Alle Texte zu diesem letzten Mahl Jesu verdanken sich liturgischer Gestaltung, die die Mahlfeiern der einzelnen Gemeinden widerspiegeln. Kein Text will berichten, was einst war, sondern begründen, warum die Gemeinde das Herrenmahl gerade so feiert, wie sie es tut.“ (Jürgen Becker, Jesus von Nazaret, Berlin, New York 1996, S. 418)
[5] Dorothee Sölle, Phantasie und Gehorsam, Stuttgart 1988, 12. Auflage, S. 63.
[6] Deshalb glaube ich eher nicht, dass Jesus, wie du, Kurt, annimmst, „letztlich zu sterben bereit war“ (Martyria, 7. Absatz). Ich denke, er wollte leben, „selig“ am Reich Gottes teilhaben bis zu seinem letzten Atemzug. Aber er ist ermordet worden.
[7] Das Reich Gottes ist für Jesus also gerade nicht „die Vision einer gerechteren Welt“, ein Projekt, das erst noch zu verwirklichen wäre, wie du, Kurt, diesen Zentralbegriff Jesu im Schlussabschnitt deines Aufsatzes interpretierst. Seinen Worten zufolge erfährt man es vielmehr dann, wenn man es lebt, durch eine menschen- und weltverbundene Existenzweise, dann aber voll und ganz, also auch nicht etwa nur ansatzweise.
[8] Was das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20 zumindest andeutet. Es endet mit der Begründung des Weinbergbesitzers für sein Verhalten in V. 14 (er nimmt alle Arbeiter als seine Mitmenschen wahr, die alle das gleiche Bedürfnis haben, nämlich ein existenzsicherndes Auskommen, und erfüllt es – unabhängig von ihrer Arbeitsleistung) und nicht mit V. 15, der diese klare Aussage, auf die die ganze Erzählung angelegt ist und hinausläuft, wieder relativiert und damit entwertet (und auch nicht – aber da besteht Einmütigkeit – mit V. 16).
[9] Seine Kreuzigung durch die römische Besatzungsmacht ist für deren Wahrheit und Überzeugungskraft in keiner Weise relevant. Ich erwähne sie daher auch nur in dieser Fußnote.