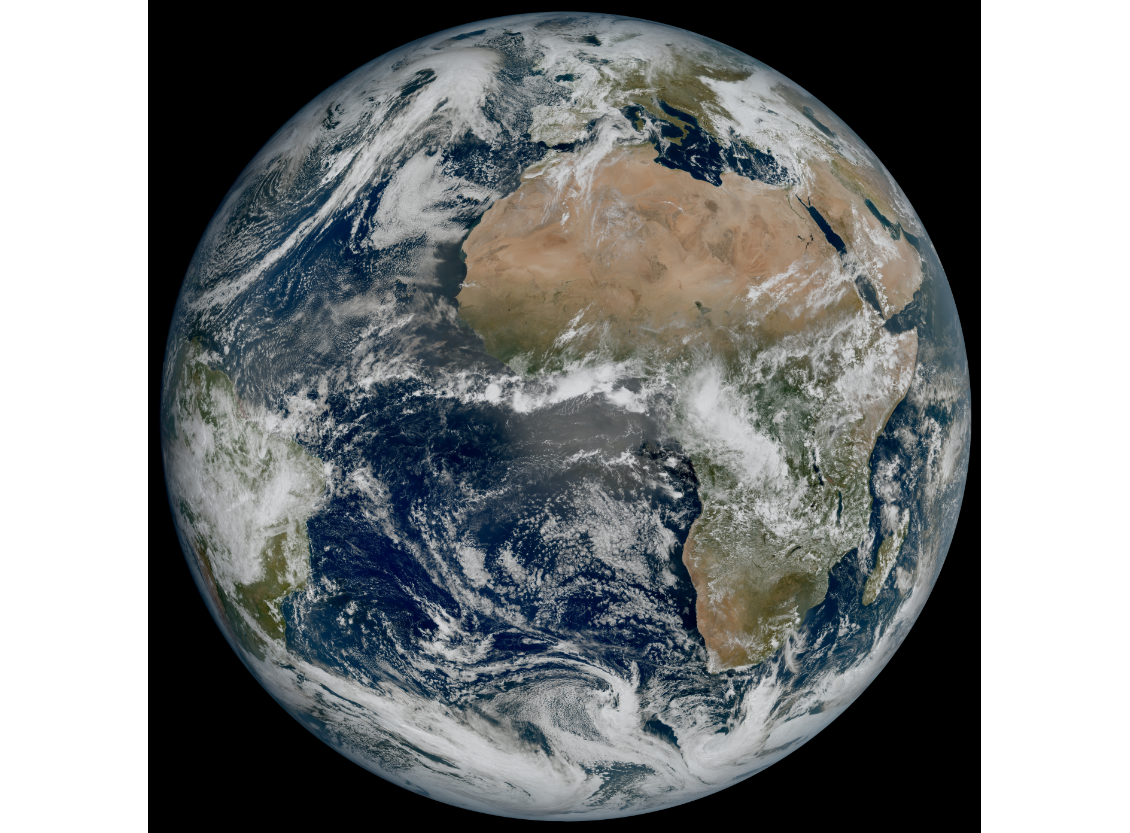Anstoß zur Erneuerung des christlichen Glaubens in Bildern, Sprache und Inhalten.
Diskussionspapier von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft für eine Glaubensreform (GfGR)
und des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins (dbv)

Vorwort
Mit diesem Papier werden die Menschen angesprochen, die daran mitwirken wollen, den Kern des Christentums, nämlich Jesu befreiende Botschaft und Praxis, für Menschen von heute wieder neu und belebend zugänglich zu machen.
Das Auftreten Jesu zeigt, dass das Christentum vom Menschen, seinen Fragen und Nöten auszugehen hat – und nicht von der religiösen Tradition.
Sicher gibt es vielerlei Ursachen dafür, dass die beiden deutschen „Großkirchen“ zusammen jährlich reichlich 500 000 Mitglieder verlieren: Individualisierung, Pluralisierung, demographischer Wandel, Ärger über kirchliche Strukturen, über Kirchensteuer, Missbrauchsskandale und den Umgang damit werden benannt. Weniger Aufmerksamkeit bekommt der Punkt, dass offenbar für einen Großteil der Bevölkerung die traditionellen Glaubensinhalte und Sprachformen kaum noch verständlich sind. „Die Kirche praktiziert Glaubenslehren und rituelle Routinen, die kaum noch Bezug zum Leben der Menschen in der Gegenwart aufweisen“, so der Religionspädagoge Prof. Joachim Kunstmann.
Gotthold Ephraim Lessing wird bezüglich des Christentums der Satz zugeschrieben: „Soll ich denn die Arznei mit der Schachtel fressen?“ Lessing plädierte dafür, den als Heilmittel empfundenen Kern des Christentums aus der Schachtel (nicht mehr verstandener dogmatischer Sätze) zu holen und damit sein Potential wieder freizulegen. Genau dies ist auch das Anliegen der Autorinnen und Autoren dieses Papiers.
Und dies war auch ein Anliegen Dietrich Bonhoeffers, der in einem Brief an Gandhi 1934 „in der Botschaft Christi die heilende Kraft für alle menschliche Bedrängnis und Not“ sah und die Zeitbedingtheit der dafür gewählten Sprachform erkannte. Im Mai 1944 (Taufbrief) prophezeite er für die Zukunft der Kirche: „Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend wie die Sprache Jesu.“
Was sehen wir als „Schachtel“ an?
Die frühe Christenheit teilte das Weltbild der Antike. Elemente dieses Weltbildes und Vorstellungen der damals herrschenden griechischen Philosophie flossen in viele frühkirchliche Glaubensaussagen ein, z. B. ins Apostolikum. Diese mythischen Bilder empfinden wir als mit dem heutigen Weltbild unvereinbar (allmächtiger Vater, Himmel, eingeborener Sohn, Jungfrauengeburt, Rechte Gottes, Wiederkunft Christi, Endgericht, Auferstehung der Toten), ebenso die Vorstellungen zum Sühnetod, die von der Theologie längst relativiert wurden. Dennoch beherrschen sie ˗ auch gegenwärtig ˗ ganz überwiegend weite Teile von Liturgie, Liedern und Gebeten. Und sie prägen durch ihre über Jahrhunderte mindestens europaweit selbstverständliche Geltung zudem umfänglich (in Kunst, Musik, Literatur, Bauten, Medien, Redewendungen etc.) die „kulturelle Tapete“ auch von Menschen, die sich selbst als säkular verstehen. Die Schachtel, das sind die von Zeitgenossen kaum noch verstandenen Bilder und Sprache der christlichen Tradition. Sie versperren für viele Menschen in unserem Kulturraum den Zugang zum befreienden und heilenden Potential der Botschaft des Jesus von Nazareth. Zum Aufmachen der „Schachtel“ gehören dreiradikale Perspektivwechsel, die hier zunächst in Kurzfassung erscheinen, ehe sie entfaltet werden. Folgerungen für die Praxis schließen sich an.
1. Perspektivwechsel bezüglich des kirchlichen Menschenbildes
Zu den Grundlagen des heutigen Menschenbildes gehört ein uneingeschränktes Ja zur Mündigkeit und Autonomie und zum uneingeschränkten Respekt vor seiner Würde. Das erfordert den Abschied von hierarchischen Vorstellungen, vom traditionellen Bild vom „Sünder“, der von Geburt an mit Schuld beladen und von kirchlicher „Erlösungslehre“ abhängig ist. Menschen haben Potential zur Entfaltung und Reifung.
2. Perspektivwechsel beim Jesus-Bild
Die lebensdienliche Botschaft Jesu sollte in die Mitte gestellt werden. „Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion, sondern zum Leben“, schrieb Dietrich Bonhoeffer in einem Brief am 18.7.1944. - Jörg Zink formulierte es so: „Das Unterscheidende des christlichen Glaubens ist im Kern nichts als die Person des unauffälligen Mannes aus Nazareth. Sollte ich ihn im Laufe meines Lebens ein wenig verstanden haben, so war er unter die Menschen getreten, um sie aus ihren Zwängen zu befreien, sie zu entlasten und sie zu ihrer eigentlichen Gestalt aufzurichten. Was nicht frei macht, sondern Furcht erweckt, was nicht in den Frieden, den inneren und äußeren führt, kann nicht von ihm ausgegangen sein. Was von ihm aus seiner großen Ferne zu uns herüberdringt, ist seine hingebende Güte und die eigentümliche Leuchtkraft seines Worts. Alles, was im Laufe der Jahrtausende um ihn herum aufgebaut worden ist, ist bestenfalls zweitrangig, wenn nicht entbehrlich“
3. Perspektivwechsel bezüglich des kirchlichen Gottesbildes
Es gibt zahllose Spekulationen über Gott aus der Antike, dem Mittelalter und der Neuzeit. Sie verstellen weithin den Blick auf das, was Menschen in ihrem tiefsten Inneren als etwas "von Gott Geschenktes" spüren (können). Vielleicht lässt es sich für „Außenstehende“ als eine Art von Verbundenheit und Geborgenheit beschreiben, die Menschen immer wieder neue Kraft schenkt, jedoch entgegen traditionellen Vorstellungen nicht "allmächtig herrscht", sondern eher als geistige Kraft und Ordnung in allem die Orientierung gibt und "in den Schwachen mächtig" ist.
Entfaltungen
Zu 1. Perspektivwechsel bezüglich des kirchlichen Menschenbildes
Notwendig ist ein Abschied vom erniedrigenden Bild des Menschen, der mit einer Schuld geboren wird, der durch ein "Opfer" erlöst werden muss und dessen Heil von der Kirche vermittelt wird. (K.-P. Jörns, Notwendige Abschiede) Dabei fallen die konfessionell unterschiedlichen Theologien weniger ins Gewicht, denn sie alle haben den antiken und mittelalterlichen Kontext unserer Glaubenssprache übernommen.
Konkret gilt es, die Mündigkeit des Menschen im Sinne der Freiheit der Kinder Gottes, sowie die Grenzen unserer überlieferten Vorstellungen von Gott anzuerkennen. „Die mündige Welt ist gottloser und darum vielleicht gerade Gott-näher als die unmündige Welt“ (D. Bonhoeffer, Brief 18.7.44). Die Vorstellung vom unmündigen Menschen ist stark durch ein monarchisches Gesellschaftsbild in der kirchlichen Sprache geprägt, über das die meisten Menschen ganz im Sinne der jesuanischen Botschaft hinausgewachsen sind. Jedem Menschen kommt – unabhängig von seinen „Leistungen“ und seiner Verletzlichkeit, seinen Defiziten und Stärken – dieselbe Würde zu. Konkrete Schwächen und Irrtümer sind nicht zu leugnen, aber es gilt, einander zu vergeben. Nur so kann es gelingen, innerlich zu wachsen und menschliche Stärken zu entwickeln, die nicht ständig in den Verdacht eines falschen Stolzes geraten.
Der bereits biblisch gesetzte Anthropozentrismus im Denken und Handeln (vgl. Gn.1) hat sich in der Aufklärung mit der Betonung der Mündigkeit des Menschen nochmals verstärkt.
Diesen Anthropozentrismus gilt es zu überwinden, denn: Der Mensch ist zwar mündig, aber nicht die „Krone der Schöpfung“ mit der Lizenz zur schonungslosen Ausbeutung der Erde. Wir sind Teil der Natur, stehen nicht darüber. (Albert Schweitzer, Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben)
Zu 2. Perspektivwechsel beim Jesus-Bild: Jesu Kernbotschaft in die Mitte stellen
Die Kernbotschaft Jesu, also das, wofür er in seinem Wirken und Lehren unter uns Menschen „gebrannt“ hat, gehört ins Zentrum unseres Glaubens. Sie findet in den Gleichnissen und der Bergpredigt einen elementaren Ausdruck. "Das westliche Christentum muss aus der Bergpredigt neu geboren werden". (Bonhoeffer, Brief an Mahatma Gandhi). Aus dieser Perspektive sind die dogmatischen Formulierungen aus überholten z.B. hellenistisch-metaphysischen Kontexten in aller Behutsamkeit zu korrigieren oder einer nachdrücklichen Neuinterpretation zu unterziehen. So wird aus dem „Erlöser“ und „Lehr-Herrn“ ein Mensch und Bruder, in dessen Reden und Handeln sich etwas „von Gott“ ereignet und zu erkennen gibt. Darin wird Jesus ein Lehrmeister, ein Coach und virtueller Begleiter für ein gelungenes Leben, ein lebendiges, leuchtendes Vorbild, ein umfassender Maßstab, der Gottes Nähe zu den Menschen verwirklicht.
Er kann uns von inneren Zwängen befreien („erlösen“), damit wir zu uns finden, mehr auf unser Herz hören, Ängste überwinden, offen und ehrlich wie Kinder mit unseren Mitmenschen reden, wieder kindliches Fragen, Staunen und Vertrauen lernen, Verletzungen überwinden, und unsere Mitmenschen verstehen.
Er lebt täglich in all jenen auf, die Frieden stiften, achtsam und sanftmütig handeln, wertschätzend miteinander umgehen, eine offene, solidarische Gemeinschaft pflegen, in der sich Menschen bedingungslos angenommen fühlen und füreinander da sind.
Nachfolge Jesu heißt demnach, im Sinne der Bergpredigt ganz weltlich und konkret: sich beherzt einzumischen, Verantwortung zu übernehmen, den Mund für die Stummen aufzumachen und, wenn es sein muss, auch um der Gerechtigkeit willen Verfolgung und Inhaftierung auf sich zu nehmen und solidarisch mit Verfolgten und Inhaftierten zu sein.
Auch an diesem Punkt müssen wir sensibel mit der christlichen Vergangenheit umgehen. Nicht alles war falsch, aber für unsere Zeit hat manches keine Gültigkeit mehr. Zu Recht sagt Hubertus Halbfas: "Solange wir Jesus anbeten, können wir ihm nicht nachfolgen": Nach Dietrich Bonhoeffer besteht „unser Christsein aus zweierlei: Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen“.
Zu 3. Perspektivwechsel bezüglich des kirchlichen Gottesbildes: Kein Bild kann umfassend beschreiben, wer oder was Gott ist.
Die kirchlich traditionellen Gottesbilder bilden heute eine unüberwindliche Barriere zu den Religionslosen, aber auch zu vielen offen spirituell interessierten Menschen. Wie kann eine Brücke gebaut werden zur Vorstellung von einem „Gegenüber“, das uns so nah ist, dass wir diese Nähe (oder Resonanz) nur spüren, aber nicht objektiv definieren können, wenn wir z.B. in Besinnung, Meditation oder Gebet aufmerksam auf sie achten.
Das, was wir „GOTT“ nennen, ist primär ein Geheimnis des Lebens, das sich nicht aufdrängt, sondern verborgen wirkt (1 Kön. 19,12). GOTT kann Menschen (vgl. 2 Mo 3,14 „Ich bin, der ich sein werde“) immer wieder anders begegnen, anders in seiner Nähe gespürt werden.
GOTT ist nicht als Machtzentrum in einer anderen Welt zu sehen, sondern eher prozesshaft als Geschehen, Beziehung, Vollzug. GOTT kann als Urgrund des Seins – doppelgesichtig – erfahren werden, d. h. ebenso in der Kraft der Verbundenheit zu allem Lebendigen wie auch in schmerzlichen Zumutungen (manch „bitterem Kelch“, der niemand erspart bleibt).
Gottesbilder haben sich bereits in der Religionsgeschichte, in der Bibel und in der Wirkungsgeschichte verändert, und ebenso verändern sie sich im Lauf des Lebens von Menschen.
Bonhoeffer schrieb: „Einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht“. In diesem Sinne gilt es Abschied zu nehmen vom Bild eines allmächtigen, physisch vorhandenen, zur Not auch gegen die Naturgesetze handelnden - oft männlich gedachten – Gottes. Er hat keine Hände, nur unsere, kann sich nicht zugunsten Einzelner oder Gruppen „erbarmen“ und „gnädig“ erweisen oder als Richter oder Lenker des Schicksals Einzelner oder gar von Völkern ins Weltgeschehen eingreifen. Die zahllosen Bilder von Gottes Handeln in der Welt und an Menschen sind auch in der Bibel zu Hause und haben ihr Recht, aber nicht auf der Tatsachen-sondern auf der Deutungsebene. Umso wichtiger ist es, ihren symbolhaften Charakter zu begreifen, der in der Erfahrung des „ganz Anderen“ mündet.
Luther erkannte: "Gott hat kein Maul": Es sind Prophetinnen und Propheten, die uns „Essentielles“ mitteil(t)en, insbesondere Jesus von Nazareth. Theologie, Wissenschaft, Philosophie, Psychologie greifen immer wieder auf, was in der Bibel gedeutet wurde, und bringen es in eine für unsere heutige Lebenswelt verständliche Sprache. „Gott will nur auf eine Weise verehrt werden: indem wir ihn leben.“ (Willigis Jäger)
Damit unterwerfen wir GOTT nicht unseren Maßstäben, setzen aber voraus, dass wir zu Ihm einen Zugang finden können. Damit gerüstet tragen wir als Menschen die volle Verantwortung für uns, unsere Mitmenschen und die Zukunft der gesamten Erde.
Bonhoeffers Gedicht aus dem Kellergefängnis des zerbombten Berlins „Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar“ lässt Menschen weit über kirchliche Kreise hinaus nachspüren, was in kirchlicher Sprache vereinfacht „Gott“ genannt wird und was einen lebensdienlichen Glauben ausmacht: Eine Quelle für Trost, Geborgenheit und Kraft zum Aufstehen in jeder Lebenslage „... am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag“. „... in solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein“, so endet Bonhoeffers persönliches "Glaubensbekenntnis".
Unsere Folgerungen und Ansätze zur kreativen Erneuerung
1. Eine Erneuerung von theologischen und kirchlichen „Sprachspielen“ (vgl. Ludwig Wittgenstein)
Passend zum heutigen Leben ist anzustreben, d.h. von Formulierungen der Liturgie, der Bekenntnisse, Lieder, Gebete oder auch von biblischem „Spruchgut“. Einzelne oder auch Gemeinden sollten ermutigt werden, dass bereits vorhandene Spektrum neuer Formulierungen für verschiedene Anlässe zu ergänzen und zu erweitern (z. B. neue Bekenntnisse und Abendmahlsliturgien, neue Texte zu traditionellen Melodien bzw. neue Melodien zu guten alten Texten). Langfristig kann nur ein intensiver Sprachgebrauch zu nachhaltigen neuen Sprachgestalten führen.
Viele Begriffe aus dem kirchlichen Sprachgebrauch können von der heutigen Welt nicht mehr oder aber nur falsch verstanden werden, da sie ein hierarchisches Weltbild vermitteln, wenn sie nicht im Kontext erklärt werden. Als erklärungsbedürftig könnten Worte gelten wie: Religion, Spiritualität, Allmacht, Sünde, Schuld, Gnade, Erbarmen, Gläubige ...
Die wachsende Fülle von Texten, Gedichten, Liedern, Gebeten und Glaubensbekenntnissen zu verschiedenen Anlässen, die zeitgemäß und ansprechend ausdrücken wollen, was glaubende und suchende Menschen anrührt und bewegt, sollte vielen Menschen zugänglich sein. Über vielfältige „Kanäle“ (Homepage, Brevier usw.) sollte ein reger Austausch dazu stattfinden. Einzelne bzw. Gemeinden sollten ermutigt werden, diese Texte in ihren geistlichen Wirkungsfeldern (Gottesdienste, Andachten, Haus- und Gesprächskreise, Kita usw.) auch praktisch umzusetzen.
Das Vaterunser stellt eine Besonderheit dar. Es ist der einzige Text, der Christen über alle Konfessionen hinweg eint. Will man in der Anrede ein anthropomorphes Gottesbild vermeiden, könnte die Einleitung z. B. folgendermaßen lauten: „Gott, du Geheimnis (oder: Quelle oder Atem) des Lebens, durch Jesus fühlen wir uns eingeladen, deine Kinder zu sein, eine große Familie alles Lebendigen … dein Name werde geheiligt …“
Die Substanz (Vater unser) bleibt dabei erhalten, nur der Wortlaut der vom Liturgen gesprochen Einleitung ist verändert. Der Rest - von allen gesprochen – bleibt unverändert.
2. Die kirchliche Bildung ist umfassend zu reformieren
Frühe Inhalte haften stark und kapseln sich dauerhaft ein, wenn sie nicht regelmäßig bearbeitet werden. Ziel ist: Kindern kein kirchliches eingehegtes Gottesbild zu „verkaufen“, das dann in der Adoleszenz- bzw. im Erwachsenenalter zusammenbricht und bedeutungslos wird („Sackgassenkatechese“ vermeiden).
Gotteskonzepte sind mehrdimensional zu denken: die Gottesbeziehung ruht auf positiven menschlichen Erfahrungen („Urvertrauen“, mindestens in Ansätzen). Zur Konstruktion ihres Gottesverständnisses nutzen Kinder, was sie – intentional oder beiläufig - an Anregungen ihrer Bezugspersonen, Medien bzw. Elementen der „kulturellen Tapete“ aufnehmen zu der Frage, wer, wo und wie GOTT ist und wirkt. Auch Kinder nehmen die Anregungen dabei nicht 1:1 auf, sondern interpretieren und gewichten die Impulse eigenständig, sind also Ko-Konstrukteure ihrer Konzepte. Schon im frühen Alter (Krippe) können nichtpersonale Konzepte unter Pflege einer Vielfalt von Gottesmetaphern angebahnt werden: Das setzt eine entsprechende radikal neuzudenkende religiöse Bildung und entsprechende neue „Sprachspiele“ voraus, und dies nicht nur bei den Menschen, die professionell Kinder auf ihrem religiösen Weg begleiten (z. B. kirchliche Mitarbeitende bzw. Religionslehrkräfte), sondern auch bei Ehrenamtlichen im Kindergarten, Kinderkirche usw. und ebenso in den Familien. Die Bildungsbemühungen im Elementar- bzw. Primarbereich und KU sollten immer auch die Eltern- bzw. die Großelterngeneration mit im Blick haben.
3. Schlaglichter zu einem neuen Fokus kirchlicher Veranstaltungen
Solche Schlaglichter sollten ansprechend sein sind für die bunte, säkulare Welt, erneuert in Inhalt, „Sprachspielen“ und Formen. Die aufgeführten Punkte verstehen sich als Einladung zur Ergänzung und Vertiefung durch Lesende, sie wollen zu Umdenken und verändertem Handeln anstoßen.
1. Kirchenräume und Gemeindehäuser sind neu zu beleben als Orte, wo Gemeinschaft und „füreinander Dasein“ gelebt wird.
2. Gottesdienst kann im Sinne Luthers im Modell einer doppelseitigen Medaille gedacht werden: Die eine Seite bildet die gottesdienstliche Versammlung als menschendienlicher „Kurzurlaub“ zum Auftanken von Leib und Seele (Sammlung). Die andere Seite ist der konkrete Lebensvollzug, in dem sich die aufgetankten Ideen und Kräfte im Miteinander in der Gesellschaft realisieren (Sendung): "Der Sabbat ist für die Menschen da, nicht umgekehrt". (Vgl. Mk.2,27)
3. Das Abendmahl kann in vielfältigen Formen ab Kindergartenalter als geistliche regelmäßige Tischgemeinschaft mit Jesus und den Mitmenschen über alle Grenzen hinweg gefeiert werden.
4. Weihnachten sollte nicht als einmaliges Ereignis der Vergangenheit begangen werden, sondern als evolutionäres, immer wieder zu vergegenwärtigendes Symbol für Hoffnung auf Erneuerung, als Focus auf das, was in allem Lebendigen in uns „geboren“ wird („der kosmische Christus“ vgl. Leonardo Boff, Jürgen Moltmann, „Geburt Gottes“ in uns, vgl. Meister Eckhart, Angelus Silesius).
5. Der Karfreitag kann lebensdienlich als Gottes Weg der Gewaltlosigkeit verkündet werden: Gott, der Seinsgrund der Welt, durchkreuzt das Prinzip der Vergeltung und Rache. Zugleich gäbe der Karfreitag als ein Gedenktag für alle Verfolgten und Inhaftierten diesem Tag auch der säkularen Welt einen neuen, zusätzlichen Sinn. Was Jesus passierte, das passiert auch heute noch täglich überall auf der Welt vielen Menschen: Sie werden wegen ihres Einsatzes „um der Gerechtigkeit willen verfolgt“, eingesperrt, gefoltert und getötet. Es geht um Verantwortung für alle leidenden Mitgeschöpfe.
6. Ostern: Wesentlich ist die Auferstehung Jesu in den Herzen und Köpfen der Menschen. „Der Auferstehungsglaube ist nicht die Lösung des Todesproblems“ (Bonhoeffer, Brief 30.4.44) „Die christliche Auferstehungshoffnung verweist den Menschen an sein Leben auf der Erde“ (Bonhoeffer, Brief 27.6.44).
7. Für Pfingsten kann der Fokus auf der Übersetzung der lebensdienlichen christlichen Botschaft liegen: „Lehret sie halten alles, was ich euch (an Lebensdienlichem!) aufgetragen habe“. „Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie die Sprache Jesu.“ (Bonhoeffer, Mai 1944). Eine Botschaft, die auch heute begeistern will und kann (im Sinne von 2. Tim 1,7: „Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“).
8. Erntedank: Die Feier kann sich wandeln - weg von dem ausschließlichen Dank für die menschliche Ernteleistung - hin zum Dank für die Erde und ihrer Lebewesen, die die Grundlage allen Wachsens und Reifens der menschlichen Nahrung bietet.
9. Neue Feste, welche die solidarische Gemeinschaft alles Lebendigen bzw. auch die Gemeinschaft z.B. mit Andersgläubigen, Randständigen oder speziellen Gruppen (Kiez, Sport, Naturschutz o. Ä.) feiern, sollten entwickelt und gepflegt werden.
4. Die Verantwortung jedes Einzelnen wie der Gesellschaft für Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ist neu zu formulieren
Dazu gehören die drei Optionen für die Gewaltfreiheit, für die Armen und für die Vielfalt des Lebendigen: Weg vom Anthropozentrismus hin zu einem Biozentrismus als wesentlichem Teil der christlichen Frömmigkeit. Das umfasst um der Glaubwürdigkeit willen gleichgewichtig das persönliche „Umhandeln“ jedes Einzelnen wie entsprechende Voten bzw. Forderungen bezüglich aller gesellschaftlicher Institutionen, d. h. Kirchen, Wirtschaft, Medien, Gesellschaft und Politik.