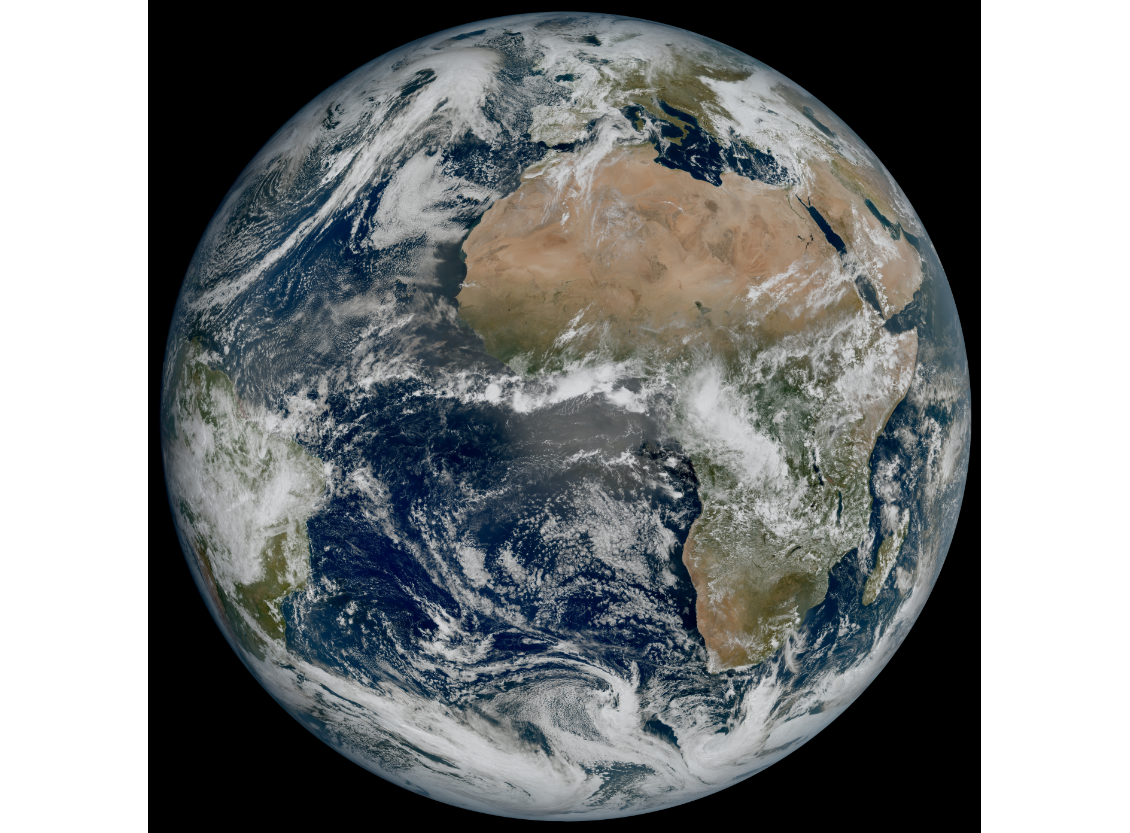Ein Abschied von der Sühnopfer-Theologie
Vorbemerkungen
1. Im Zentrum unserer Glaubenslehre gibt es den Satz: Jesus Christus ist als Sühne für unsere Sünden am Kreuz einen Opfertod gestorben; oder zugespitzt: Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert, um uns mit Ihm zu versöhnen. Ich werde im Folgenden diese Sätze in Frage stellen und als Sätze meines Glaubens ablehnen. Freilich werde ich zugleich ein anderes Verständnis des Kreuztodes Jesu vorstellen. Aber mit beidem will ich niemandem, die oder der mit der bisher üblichen Sühnopfer-Theologie glauben und leben kann, diesen Glauben auszureden versuchen. Ich möchte nur den vielen, die mit diesen Glaubenssätzen nichts mehr anfangen können, gar an ihnen Anstoß nehmen, eine entlastende Interpretation anbieten.
2. Ich muss als bekannt und akzeptiert voraussetzen, dass die Bibel nicht eine von Gott wörtlich diktierte Schrift ist, sondern eine Sammlung von Schriften der jüdischen und christlichen Religion, die zwar überwiegend von Gott inspiriert, aber von Menschen formuliert, redaktionell bearbeitet und verändert wurden. Ihre Inhalte wurden über viele Jahrhunderte (im Neuen Testament Jahrzehnte) nur mündlich überliefert, und ihre Texte entstanden in ganz verschiedenen Epochen religiöser Tradition. So sind große Unterschiede, und sogar Widersprüche zwischen ihren Aussagen verständlich. In vielen Fällen müssen wir uns entscheiden, was wir glauben können und wollen. Insofern wird uns bei den nachfolgenden Überlegungen das Argument „Aber in der Bibel steht doch ...“ nicht helfen.
I. Befremdung
Der Anblick des gekreuzigten Christus und die Rede von seinem Opfer für uns sind im Christentum so allgegenwärtig und so sehr Gewohntes, dass es nötig ist, ein paar Schritte Abstand zu nehmen, um das Befremdliche, gar Ärgerliche daran zu erkennen.
1. Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, wie Sie in einem fernen Land einer fremden Religion begegnen, von der Ihnen erzählt wird, dass deren Begründer gehenkt worden sei. Was würden Sie empfinden und denken, wenn sie dort in allen Tempeln einen Galgen mit dem Gehenkten daran sähen? So geht es vermutlich Afrikanern oder Asiaten, wenn sie zum ersten Mal dem Christentum begegnen!
2. Können wir uns vorstellen, wie es auf unsere Kinder wirkt, dass in allen unseren Kirchen an zentraler Stelle, in vielen Häusern, manchmal am Wegrand und sogar in Kindergärten und Klassenräumen der Kruzifixus, oft mit blutenden Wunden und qualvoll gekrümmtem Körper, dargestellt ist? Was mögen die Kinder denken, wenn ihnen gesagt wird, Gott habe das so gewollt? Wie tief sind diese Bilder und Vorstellungen aus der Kindheit in uns eingeprägt?
3. Wie ist es zu erklären, dass – zumindest im Protestantismus – der Karfreitag als höchster Feiertag gilt und nicht der Ostersonntag? Glauben wir denn an den gekreuzigten oder an den auferstandenen Christus? Warum haben wir - entgegen allen biblischen Berichten – Christus am Kreuz fixiert?
4. Der Tod Jesu am Kreuz wird theologisch als das entscheidende Heilsereignis behauptet. Heißt das, dass die Inkarnation Gottes in diesem Jesus von Nazareth, dessen Leben und Wirken und Predigen wertlos geblieben wären, wenn Jesus als alter, weiser Mann in einem Bett gestorben wäre?
5. Da religiöse Opfer (engl. sacrifice) ganz aus unserem Kulturkreis verschwunden sind, denken wir bei dem Wort ,Opfer' am ehesten an Kriegsopfer, Unfallopfer, Katastrophenopfer (engl. victim), also passive, unschuldige, sinnlose Opfer eines ‚blinden Schicksals‘. Daneben kennen wir Berichte, wo einzelne Menschen sich aufopfern, um anderen das Leben zu retten. Aber beim Sühnopfer Jesu ist ganz anderes gemeint!
Diese befremdenden Wahrnehmungen sind wohl Grund genug, die entsprechenden theologischen Aussagen genauer zu befragen.
II. Infragestellung
1. Biblische Belege zum Sühnopfer-Gedanken finden sich weder in den synoptischen Evangelien (Mt, Mk, Lk) noch im Johannes-Evangelium (auch nicht Joh 3,16!). Zwar kündigt Jesus in den Evangelien sein bevorstehendes Leiden und Sterben als unvermeidliches Geschehen an, aber nicht als gewolltes Sühnopfer. In den Einsetzungsworten beim Letzten Mahl Jesu heißt es „Das ist mein Leib“ (nur Lukas fügt hinzu „der für euch hingegeben wird“) und „Das ist mein Blut, das für euch/ für viele vergossen wird“ (nur Matthäus fügt hinzu „zur Vergebung der Sünden“). Diese Formulierungen werden als Eintragungen aus der urchristlichen Abendmahlspraxis vermutet. Der ‚historische Jesus‘ hat offenbar von der späteren Sühnopfer-Theologie nichts im Sinn gehabt. (Siehe dazu auch unten 4.) Erst bei Paulus, dort aber massiv, erscheint die Deutung von Jesu Tod am Kreuz als ein von Gott selbst (!) inszeniertes Sühnopfer (Röm 3,25; 5,17-19; 7,4; 8,32; 2.Kor 5,19 u.ö.). Im Hebräerbrief wird Jesu Opfertod zu einem Selbstopfer. Als Hoherpriester übertrifft er die täglichen Sühnopfer im Jerusalemer Tempel ins Unermessliche, indem er, der Sündlose, sich „ein für allemal“ für die Sünden der Menschen opfert (Hebr 7,27; 9,12 und 26-28 u.ö.). Die Offenbarung des Johannes spricht vom „Lamm Gottes“, das zur Schlachtbank geführt wurde und der Welt Sünde trug. Es scheint – gerade für Paulus – verständlich, dass biblische Autoren das Heilsgeschehen in Jesus Christus durch Kategorien jüdischer und hellenistischer Opferrituale für ihre Zeit verstehbar machen wollten. Aber in doppelter Weise erlagen sie dabei einem Rückfall.
2. Das jüdische Opferverständnis erfuhr in seiner religionsgeschichtlichen Entwicklung zwei starke Korrekturen. Zum einen verstehen wir heute die Erzählung um Abrahams versuchte Opferung seines Sohnes Isaak (1. Mose 22, 1-14) als Zurückweisung der bis dahin noch praktizierten Menschenopfer. Die ersatzweisen Tieropfer wurden allerdings noch zu Jesu Zeiten im Jerusalemer Tempel massenhaft vollzogen. Zum anderen haben immer wieder Propheten grundsätzliche Kritik am Opferkult geübt. Sie forderten soziales Handeln statt Opfer (Amos 4,4f; 5,21ff; Hos 4,4ff; 14,2f; Jes 1,10ff; Jer 7,7ff; Jes 43,23ff; Ez 20,39 u.ö.). An diese prophetische Kritik knüpfte später Jesus an (vor allem in der Bergpredigt Mt 5 – 7). Die Sühnopfer-Theologie eines Paulus wie der späteren kirchlichen Dogmen- und Liturgie-Entwicklung stellt also einen fatalen Rückfall dar auf die religionsgeschichtliche Stufe von Menschenopfern.
3. Gravierender ist der im Sühnopfer-Glauben enthaltene Rückfall in der Entwicklung des Gottesverständnisses. Wir begegnen ja in der Bibel einem breiten Spektrum von Gottesvorstellungen: vom Töpfer- und Gärtner-Gott im älteren Schöpfungsmythos (1.Mose 2), über einen Heerführer- und Rächer-Gott, einen zornigen und eifersüchtigen Gott hin zu dem barmherzigen, verzeihenden Gott (bereits im Alten Testament!), bis zu dem Gott, den Jesus vertrauensvoll als Vater anspricht und bis hin zu Abstraktionen wie „Gott ist Liebe“ oder „Gott ist Geist“ (Johannes). Die Vorstellung, Gott ließe sich durch Opfer beeinflussen und er hätte eines Opfers, gar einer Opferung seines eigenen, geliebten Sohnes bedurft, um sich mit den Menschen versöhnen zu können, ist also ein Rückfall in ein früh-religiöses Verständnis von Gott. „Die dahinterstehende Gottesvorstellung ist geprägt von einer Gerechtigkeit, die im Grunde Unerbittlichkeit ist: Einer musste die offene Schuld begleichen.“ (Jörns, S.329)
4. Dieses Verständnis von Gott, der ein Opfer braucht, steht in krassem Widerspruch zur Botschaft Jesu von dem bedingungslos und grenzenlos liebenden Gott (z.B. im Gleichnis vom ‚Verlorenen Sohn‘), wie ihn auch Paulus verkündet. Wer die grausame Hinrichtung am Kreuz als ein von Gott gewolltes Sühnopfer interpretiert, versperrt den Blick auf den liebenden Gott der freien Gnade, der zur Erlösung von uns Sündern keinerlei Vorleistung, schon gar nicht einen solch blutigen Gewaltakt braucht. „Wir müssen uns heute entscheiden, ob wir Jesu Christi Weg und Verkündigung oder weiterhin einer Theologie folgen wollen, die das Evangelium in einem zentralen Punkt widerruft.“ (Jörns, S.321) (Zitat von Bischof Huber, Jörns, S.328, Anm.77)
5. Diese Entscheidung ist für mich klar, und es geht m.E. für uns heutige Christen darum, Abschied zu nehmen von Glaubenssätzen, die als irreführend erkannt sind – wie dem vom Sühnopfertod Jesu –, Abschied zu nehmen ohne Groll, ohne Überheblichkeit, aber doch in klarer Trennung; vor allem aber mit der Aussicht auf eine neue Perspektive: eine umso deutlichere Freilegung der wahren Botschaft Jesu.
III. Neufassung
1. Wir sollten nicht auf Golgatha stehen bleiben, sondern – so wie damals die Frauen – den toten Jesus vom Kreuz nehmen, ihn beweinen und begraben. Dann bliebe das leere Kreuz als wichtige Erinnerung an sein Leiden und Sterben. Aber wir könnten den Weg Jesu Christi weitergehen, auch das leere Grab hinter uns lassen und ihm in der Auferstehung lebend begegnen. Statt zum Gekreuzigten zu beten, lasst uns den Auferstandenen feiern!
2. Wir sollten den Tod Jesu in den Zusammenhang seines ganzen Lebens stellen: von seiner Geburt in ärmlichen Verhältnissen, über seine Taufe durch Johannes, sein öffentliches Auftreten in Galiläa als Wanderprediger und Heiler mit massenhaftem Zulauf und ersten Konflikten mit Pharisäern und Schriftgelehrten; bis zu seinem Gang in das religiös-politische Machtzentrum Jerusalem, wo es zur Zuspitzung des Konfliktes mit den religiösen Führern, zu seiner Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung kommt. Schließlich gehören auch die Erfahrungen seiner engsten Freunde mit ihm als Auferstandenem zum Ganzen seines Lebens. Und dieses sein ganzes Leben ist das Heilsereignis! Als Wichtigstes ist dabei festzuhalten, dass Jesus einen Glauben an den bedingungslos liebenden Vater-Gott vermittelte und den Anbruch, ja, die volle Präsenz des Reiches Gottes, d.h. der Wirklichkeit Gottes verkündete. Was gibt es darüber hinaus zu sagen?!
3. Aus diesem Zusammenhang ist der Tod Jesu durch die Kreuzigung als Märtyrertod zu verstehen. Jesus von Nazareth wurde der erste – und keineswegs einzige! – Märtyrerzeuge für die von ihm vertretene Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes. Dazu gehört auch der Umstand, dass er nicht floh, als es noch möglich war, und sich strikt gewaltlos der herrschenden Gewalt auslieferte. Dies Beispiel Jesu, der unser Bruder vor Gott war, durchgehalten trotz Angst und Zweifel und unter qualvollsten Bedingungen, hat seitdem unzählige andere Märtyrer der Liebe bestärkt und Menschen auch in ,kleineren' Leidsituationen getröstet. Es war ein Opfer im Sinne einer äußersten Hingabe, wie sie auch von anderen Menschen vor ihm und nach ihm gelebt wurde.
4. Wir glauben Jesus Christus als Inkarnation Gottes, d.h. als Verkörperung des göttlichen Geistes. Deshalb können wir Jesu grauenvolle Hinrichtung als Gottes Gegenwart in äußerstem Leid verstehen. Gott selbst ist unser Leidensgenosse! Dies ist eine radikale Überschreitung aller religiösen Gottesvorstellungen. (Vgl. den Hymnus in Phil 2,5-11) Diese Deutung des Kreuzes Christi überbietet und ersetzt für mich alle Opfertod-Vorstellungen. Und sie entspricht am deutlichsten der Gesamtbotschaft Jesu. Denn dessen Verkündung der Gegenwart Gottes als „Reich Gottes“ und sein Vertrauen in den liebenden Vater geben auch inmitten von Leid Kraft und Hoffnung zur Überwindung allen Leidens.
Literatur zum Thema:
- Klaus-Peter Jörns: Notwendige Abschiede – Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum. 2.Aufl.2005, S. 286 ff. - Claus Petersen: Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes – Aufruf zum Neubeginn. Stuttgart 2005