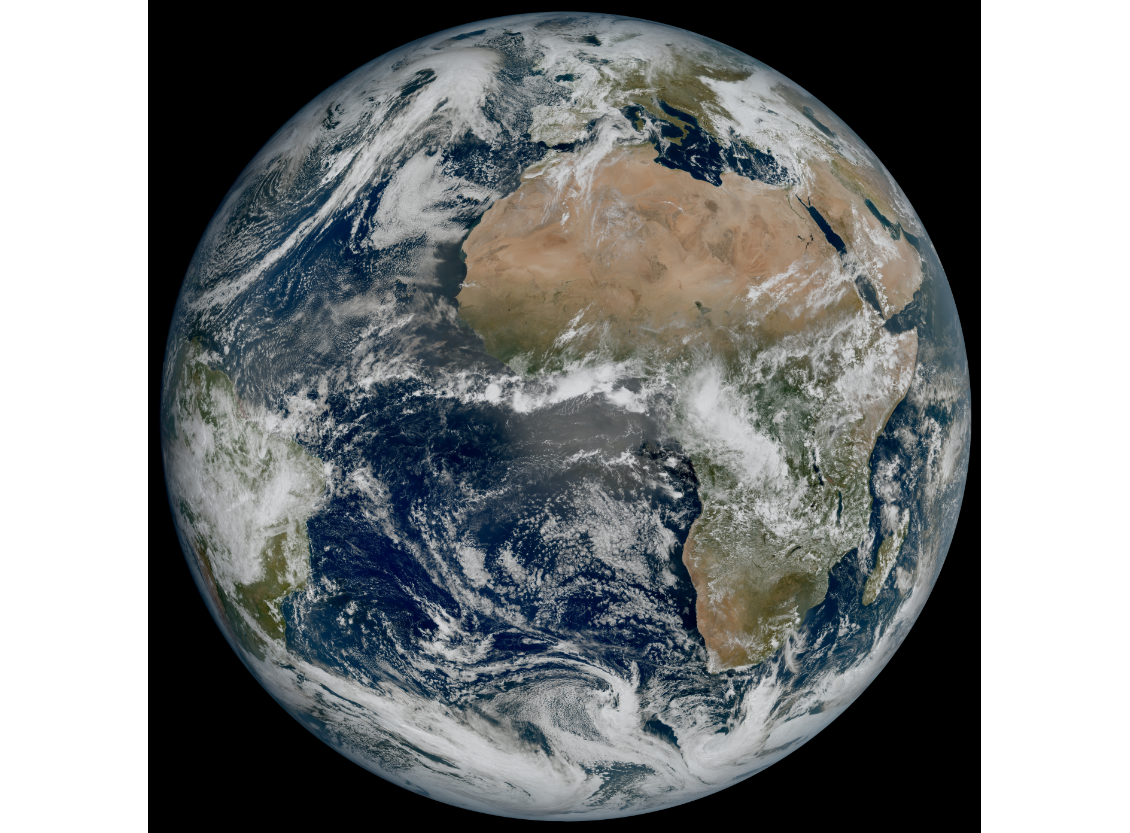Glaubensbekenntnisse damals und heute
Einleitung
Wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum: Vor 1700 Jahren wurde auf dem ersten öku-
menischen Konzil das sogenannte Nizänische Glaubensbekenntnis beschlossen.
Auch wenn sich in der westlichen Christenheit das im 5. Jahrhundert entstandene
Apostolische Glaubensbekenntnis durchgesetzt hat: Das Nizänische Glaubensbe-
kenntnis (nicht zu verwechseln mit dem bekannteren und nahe verwandten Nizä-
nisch-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, das in der evangelischen Kir-
che an besonderen Feiertagen gesprochen wird) ist das erste große christliche Glau-
bensbekenntnis und das meistanerkannte Bekenntnis im Christentum, da auch die
altorientalischen Kirchen es bestätigt haben.
Wir feiern in diesem Jahr also ein Jubiläum, aber außerhalb der Kirche interessiert
das niemanden. Und auch innerhalb der Kirchen Deutschlands ist die Jubiläumsstim-
mung eher gedämpft. Das überrascht nicht: Die Bedeutung der traditionellen Glau-
bensbekenntnisse geht immer weiter zurück. Auch wenn das Apostolische Glau-
bensbekenntnis immer noch regelmäßig in Gottesdiensten gesprochen wird: Selbst
die treuen Kirchenchristen sprechen es - so ist meine Erfahrung - kaum mehr mit in-
nerer Anteilnahme. Man kennt die Worte noch, aber sie berühren nicht mehr. So
gesehen bietet das Jubiläum wenig Anlass zum Feiern (wie überhaupt in der Kirche
in Zeiten der Krise Feierstimmung nicht recht aufkommen will).
Auch wenn man das Jubiläum nicht ausgelassen feiern mag, es eröffnet jedoch die
Gelegenheit, das Thema "Glaubensbekenntnisse" ganz allgemein in den Blick zu neh-
men. Wie soll unser Umgang mit Glaubensbekenntnissen zukünftig sein: Sollten wir
die alten Glaubensbekenntnisse weiterhin sprechen? Oder stattdessen neue Be-
kenntnisse formulieren? Oder beides tun (eine Kompromissformel, auf die wir uns in
der Kirche ja gerne einigen)? Oder sollten wir künftig auf Glaubensbekenntnisse gar
generell verzichten?
Darum soll es im Folgenden gehen. Ich lade Sie zu einem Gedankenspaziergang ein,
der uns zunächst zu den traditionellen Bekenntnissen zurückführt und dann mit-
nimmt zu den gegenwärtigen Herausforderungen christlichen Bekennens.
A) Anlässe traditioneller Glaubensbekenntnisse
Wie kam es eigentlich zu Glaubensbekenntnissen? Um diese Frage zu beantworten,
ist ein kurzer Blick in die Geschichte des Christentums lehrreich.
1) Regelmäßig wurden in der Geschichte des Christentums Konzilien einberufen, um
dogmatische Streitigkeiten auszuräumen. Um ein Beispiel zu geben: Im 4. Jahrhun-
dert war die Einheit der Kirche bedroht, weil unterschiedliche Auffassungen über die
Person Jesu im Verhältnis zu Gott in Umlauf waren. Auf dem Konzil von Nizäa 325 n.
Chr. wurde nach zum Teil heftiger Diskussion eine gemeinsame dogmatische Linie
formuliert. Gleichzeitig grenzte man sich gegenüber abweichenden Lehren ab. Das
Ergebnis der theologischen Verständigung fand Eingang in das Nizänische Glaubens-
bekenntnis. Seine Erweiterung, das Nizänisch-Konstantinopolitanische Glaubensbe-
kenntnis, wurde auf dem 4. ökumenischen Konzil zum ersten Mal feierlich verlesen -
und führte in der Folge dazu, dass die altorientalischen Kirchen aus der bisherigen
Einheit ausscherten, weil sie das Bekenntnis nicht mittragen wollten.
2) Im Zuge der Abspaltung der protestantischen Kirche von der römisch-katholischen
Kirche sahen sich die Reformatoren vor die Aufgabe gestellt, zu benennen, was die
Identität der eigenen Glaubensauffassung ausmacht. So entstanden innerhalb kur-
zer Zeit eine Reihe von Schriften und Bekenntnissen. In diesen wurden nicht nur die
Differenzen zur römisch-katholischen Auffassung deutlich, sondern auch Differenzen
unter den einzelnen Reformatoren unübersehbar. Diese Differenzen führten dazu,
dass sich unterschiedliche Typen protestantischer Identität ausprägten (lutherische,
reformierte, später auch unierte Kirchen). Die protestantischen Bekenntnisschriften
bilden, in jeweils charakteristischer Auswahl, bis heute die Basis der Identität der
protestantischen Kirchen.
Dieser kurze Blick in die Kirchengeschichte zeigt auf: Es gab es immer einen konkre-
ten Anlass für die Entstehung von Glaubensbekenntnissen. Ob es um dogmatische
Lehrstreitigkeiten in der bestehenden Kirche ging oder um die Formulierung von
Grundüberzeugungen zu Beginn einer neuentstehenden Kirche: Immer war die For-
mulierung von Glaubensbekenntnissen Identitätsbestimmung. Die theologischen
Verständigungen beinhalteten dabei immer auch inhaltliche Abgrenzungen. Dieser
Verständigungsprozess fand entweder nach einer Abspaltung statt oder führte an-
schließend oft zu Abspaltungen.
B) Die Problematik traditioneller Glaubensbekenntnisse
Wie ist das: Sind die traditionellen Glaubensbekenntnisse, die zu einer bestimmten
Zeit aufgrund eines konkreten Anlasses entstanden sind, bleibend gültige Lehr- und
Glaubenszeugnisse? Nur in diesem Fall sollte man sie weiterhin regelmäßig verwen-
den. Dann aber müsste in Zeiten schwindender Resonanz ihre Bedeutung für die
Christen heutiger Zeit regelmäßig erläutert werden, um einem gedankenlosen Her-
unterleiern entgegenzuwirken. Oder sind die traditionellen Glaubensbekenntnisse
zwar kirchengeschichtlich bedeutsam, helfen uns aber für die Bestimmung unseres
Glaubens in heutiger Zeit nicht mehr? Dann wäre die Zeit ihrer regelmäßigen Ver-
wendung bei Gottesdiensten und Taufen vorbei.
Ich will im Folgenden begründen, warum ich der zweiten Ansicht zuneige:
1) Nur das Nizänum, das älteste Glaubensbekenntnis, war in der damaligen Chris-
tenheit allgemein anerkannt. Aber gerade dieses spielt in der Frömmigkeitspraxis
heutiger Kirchen keine Rolle. Alle anderen Glaubensbekenntnisse haben nur partiku-
läre Bedeutung. Sie sind also gerade nicht Ausdruck der gesamten Christenheit, wie
in Gottesdiensten der evangelischen Kirche als Einleitung zum Apostolischen Glau-
bensbekenntnis oft behauptet wird. Unterschiedliche Auffassungen zum Nizänisch-
Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis (der Streit um das "filioque"!) waren
sogar ein wichtiger Grund dafür, dass die Welt- und Ostkirche sich 1054 n. Chr.
trennten.
2) Dass das Nizänum heute keine Rolle mehr spielt, hängt unter anderem damit zu-
sammen, dass die, die einen anderen Glauben propagieren, im Nizänum verflucht
werden. Diese Verfluchung (sog. anathema) bedeutet: Verurteilung durch die Kir-
che. Sie geht mit dem Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft einher und ist
kirchenrechtlich mit einer Exkommunikation gleichzusetzen. 1054 belegten sich die
östlichen und die westlichen Kirchen wechselseitig mit Anathemata. In den Schmal-
kaldischen Artikeln, einer protestantischen Bekenntnisschrift, spricht Luther zwar
gegenüber der katholischen Kirche keine Verfluchung aus, aber er nimmt kein Blatt
vor den Mund und bezeichnet den Papst unter anderem als Satan. Das sind Worte,
die bewusst verletzen wollen.
Summa summarum: Die Verfluchungen und harten Abgrenzungen, die im Zusam-
menhang von Glaubensbekenntnissen und Bekenntnisschriften ausgesprochen wur-
den, sind ein schweres Erbe, die das Verhältnis von Christen untereinander bis heute
belastet.
3) Das heute verbreitete Apostolische Glaubensbekenntnis enthält diese Verfluchun-
gen und harten Abgrenzungen nicht. Aber so, wie es heute in der evangelischen und
der katholischen Kirche gesprochen wird, ist es eher Ausdruck des konfessionellen
Getrenntseins als Ausdruck des gemeinsamen Glaubens. Der Wortlaut ist in beiden
Kirchen der gleiche bis auf einen signifikanten Unterschied: Während evangelische
Christen von der "christlichen" Kirche sprechen, wird in der katholischen Kirche von
der "katholischen" Kirche gesprochen. Nun heißt "katholisch" von seinem griechi-
schen Wortsinn her zwar "allumfassend". Das wissen aber die meisten katholischen
Christen nicht und meinen, damit wäre die römisch-katholische Kirche gemeint. Die-
ses Missverständnis geht die römisch-katholische Kirche bewusst ein.
4) Ganz allgemein gilt: Glaubensbekenntnisse beziehen sich - wie wir gesehen haben
- immer auf spezifische Herausforderungen ihrer Zeit. In den ersten Konzilien ging es
um dogmatische Streitigkeiten bezüglich der Frage, wie Jesus Christus zu verstehen
ist (Christologie) und wie sich sein Verhältnis zu Gottvater und dem Heiligen Geist
darstellt (Trinität). Diese Thematik stand in den altkirchlichen Glaubensbekenntnis-
sen im Mittelpunkt.
Wenn Christen heute ihren Glauben zum Ausdruck bringen, spielen für sie diese alt-
kirchlichen Auseinandersetzungen um Christologie und Trinität keine wesentliche
Rolle. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die altkirchlichen Glaubensbekennt-
nisse für sie eine immer geringere Bedeutung haben.
5) Die Geistesströmung, auf deren Hintergrund die dogmatischen Streitigkeiten der
Alten Kirche erörtert wurden, war die griechische Philosophie. Alle Kontrahenten
argumentierten von ihr her und verwendeten für ihre Position entsprechende philo-
sophische Begrifflichkeiten.
Die griechische Philosophie bestimmt unsere moderne Geisteshaltung nur noch am
Rande. Deshalb sind uns die Probleme, über die damals gestritten wurden, auch
fremd geworden.
6) Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das - wie schon erwähnt - als einziges der
altkirchlichen Glaubensbekenntnisse heute noch regelmäßig verwendet wird, glie-
dert sich in die drei Abschnitte "Gott", "Jesus Christus" und "Heiliger Geist". Darin
spiegel sich die zentrale Bedeutung, die die Trinität in der Alten Kirche innehatte.
Anhand dieser Gliederung wird die christliche Heilsgeschichte dargestellt als eine
Linie, die von der Schöpfung bis hin zum ewigen Leben verläuft. In dieser Darstellung
spielt die Verkündigung Jesu keine Rolle. Stattdessen geht es ausschließlich um sei-
nen Tod und seine Auferstehung. Das Überspringen der Reich-Gottes-Botschaft ist
ein großes Manko des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Denn damit fehlt ein
wesentlicher Aspekt des christlichen Glaubens.
7) Die Konzeptionierung einer einlinigen Heilsgeschichte bedeutet aber auch ganz
allgemein eine Verengung der biblischen Darstellung. Um ein paar Beispiele zu nen-
nen: Das Jüngste Gericht und die Jungfrauengeburt sind Teil der matthäischen Sicht
Jesu, in den anderen Evangelien kommen sie nicht vor. Die Himmelfahrtserzählung
wiederum findet sich nur beim Evangelisten Lukas. Sie steht in Spannung zu der
Sicht der anderen Evangelien, die das Geschehen nach der Auferstehung Jesu ganz
anders beschreiben (während das Markusevangelium mit der Schilderung der Aufer-
stehung Jesu ursprünglich endete, bleibt der Auferstandene im Matthäus- und dem
Johannesevangelium bei seinen Freunden). Und schließlich: Die Bedeutung Jesu aus-
schließlich auf seinen Tod und seine Auferstehung zu beziehen, entspricht der An-
sicht von Paulus, dem großen Missionar der Urkirche. Damit legt das Apostolische
Glaubensbekenntnis die theologische Ansicht von Paulus als maßgebliche Anschau-
ung für das Christentum zugrunde.
Ganz allgemein gilt also: Dadurch, dass das Apostolische Glaubensbekenntnis eine
einlinige Darstellung der Heilsgeschichte verfolgt, blendet es wichtige biblische Ele-
mente aus und setzt willkürliche Schwerpunkte.
8) Überhaupt - und das ist mein generellster Kritikpunkt - ist die Frage, ob eine
durchkomponierte Glaubenslehre, wie sie im Apostolischen Glaubensbekenntnis
zum Ausdruck kommt, dem christlichen Glauben überhaupt angemessen ist. Die
Sprache der Bibel ist poetisch und lässt sich schwerlich auf einen begrifflichen Nen-
ner und eine logische Linie bringen. Aber genau das versucht das Glaubensbekennt-
nis. Das führt dazu, dass das Glaubensbekenntnis auf heutige Menschen wie eine al-
ternativlose Tatsachenkette wirkt, die man zu glauben hat, wenn man ein guter
Christ sein will.
Aus den genannten Gründen bin ich der Meinung, dass wir die altkirchlichen Glau-
bensbekenntnisse in der heutigen Zeit nicht mehr regelmäßig verwenden sollten. In
besonderen Situationen, zum Beispiel in diesem Jahr, dem Jahr des Jubiläums des
Nizänums, können sie jedoch genutzt werden, um über das nachzusinnen, was Men-
schen damals bewegt hat, und zu überlegen, inwiefern das uns in unserer heutigen
Zeit inspirieren kann.
C) Neue Glaubensbekenntnisse?
Sollen wir in der heutigen Zeit neue Glaubensbekenntnisse kreieren? Oder vielleicht
besser auf Glaubensbekenntnisse ganz verzichten?
Meiner Meinung nach sind Glaubensbekenntnisse weiterhin von hoher Bedeutung.
In heutiger Zeit vielleicht sogar mehr denn je: Für uns selbst als Versuch, Klarheit zu
gewinnen über unsere religiöse Identität. Aber auch, um sprach- und auskunftsfähig
zu sein gegenüber unserer Mitwelt. Vermutlich ist Kirche in heutiger Zeit auch des-
halb so wenig attraktiv, weil uns das immer weniger gelingt.
D) Erste Überlegungen
Was könnten hilfreiche Gesichtspunkte sein für neue Glaubensbekenntnisse?
1) Der Sinn traditioneller Glaubensbekenntnisse bestand darin, den Gehalt des
christlichen Glaubens zu bestimmen. Dies ist meines Erachtens auch weiterhin die
zentrale Funktion heutiger Glaubensbekenntnisse.
2) Glaubensbekenntnisse sind, wie wir gesehen haben, immer Kinder ihrer Zeit. Sie
entstanden, weil große Herausforderungen zu bewältigen waren, und setzten sich
dabei mit den herrschenden Geistesströmungen auseinander.
a) Die große kirchliche Herausforderung unserer heutigen Zeit ist die immer größere
Distanz vieler Menschen zum Christentum. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die mo-
derne Denkweise, die mithilfe des Verstandes Dinge kritisch hinterfragt und auf
Überprüfbarkeit von Erkenntnissen Wert legt. Viele Menschen sind der Meinung,
dass der christliche Glaube mit dieser Denkweise, die in den Wissenschaften zu ent-
sprechenden Erkenntnissen geführt hat, nicht vereinbar ist und deshalb nicht mehr
in die moderne Zeit passt. Dies gilt es in heutigen Glaubensbekenntnissen im Blick zu
haben. Modernen, kritisch denkenden Menschen einen Zugang zur christlichen Reli-
gion vermitteln: Darum wird es in heutigen Glaubensbekenntnissen zentral gehen
müssen.
b) Glaubensüberzeugungen sind nie losgelöst davon, wie wir die Wirklichkeit allge-
mein anschauen und verstehen. Weil sich unsere Weltanschauung und unser Welt-
verständnis gegenüber früheren Zeiten verändert hat, wird sich auch unsere Sicht
auf den christlichen Glauben verändern müssen. Diese Veränderung sollte in heuti-
gen Glaubensbekenntnissen zum Ausdruck kommen. Wir sollten deshalb in aller
Deutlichkeit auch sagen, was wir nicht (mehr) glauben. Das wird der Klarheit und
dem Profil unserer Glaubensüberzeugung nur gut tun.
3) Gerade weil Glaubensbekenntnisse immer Kinder ihrer Zeit sind, sollten wir die
ihre Gültigkeit nicht universalisieren. Sie sind Versuche, den Gehalt des christlichen
Glaubens zu bestimmen. Darin liegt ihr Wert – und ihre Grenze! Meines Erachtens
braucht es eine Vielzahl von Glaubensbekenntnissen. Es wird immer weniger gelin-
gen, sich auf ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu einigen. Vielleicht ist das
auch gut so: Der christliche Glaube ist vielgestaltig und kann schwerlich auf einen
Nenner gebracht werden.
E) Wie man theologisch ansetzen könnte
Jedes Glaubensbekenntnis enthält eine implizite Theologie. Diese Theologie be-
stimmt nicht nur die einzelnen Aussagen, sondern auch den Aufriss des Glaubensbe-
kenntnisses. Wenn ich im Folgenden Gedanken anstelle über die Inhalte neuer
Glaubensbekenntnisse, dann erfolgt das aus meiner spezifischen theologischen War-
te. Andere, die von einer anderen theologischen Anschauung geprägt sind, werden
zu anderen Folgerungen gelangen.
Zentral für mein theologisches Nachdenken sind die Wahrnehmungen und das
Selbstverständnis der Menschen in der heutigen Zeit - zu denen ich ja selbst gehöre.
Die theologische Strömung, der ich mich dabei zuordne, nennt man (etwas missver-
ständlich) "Liberale Theologie".
Liberale Theologie setzt bei dem Phänomen "religiöse Erfahrung" an. Was ist damit
gemeint? Menschen haben in ihrem Leben Erlebnisse unterschiedlicher Art. Manche
Erlebnisse können von einer besonderen Intensität sein: Zum Beispiel ein traumhaf-
ter Sonnenuntergang, ein unvergleichliches Kunstwerk oder eine folgenschwere
Gewissensentscheidung. Viele Menschen empfinden diese Intensität - und gehen
nach kurzer Zeit wieder zur Tagesordnung über. Manche Menschen haben jedoch
die Empfindung, dass in einem solchen Erlebnis für einen Moment ihr Alltagshori-
zont aufreißt und dahinter ein viel weiterer, ja unendlicher Horizont aufscheint. Sie
ahnen für einen Moment einen tieferen Sinn hinter allem. Dieses Gefühl kann zu
einer Veränderung der gesamten Lebenshaltung führen.
Wie kommt es, dass Menschen äußerlich gesehen das Gleiche erleben, aber es an-
ders wahrnehmen? Sie deuten ihr Erleben unterschiedlich. Wer dem Erlebnis keine
tiefere Bedeutung zumisst, ordnet es in seinen Alltag ein - wie alle anderen Erlebnis-
se auch. Wer in dem Erlebnis jedoch das Gefühl von etwas Größerem in sich spürt,
der deutet es religiös. Bei einer religiösen Erfahrung kommt also zweierlei zusam-
men: Das besondere Erleben - und die religiöse Deutung dessen.
Die Empfindung von etwas Größerem, Tieferem, Unendlichem hinter dem Erlebten
in Worte zu fassen ist schwer. Religiöse Deutung bedient sich deshalb zumeist be-
sonderer sprachlicher Mittel: Sie verwendet Symbole und Metaphern. Symbole sind
doppelsinnig: Hinter der wörtlichen Bedeutung liegt eine übertragene Bedeutung
verborgen. Metaphern sind Vergleiche. Diese beiden Mittel unserer Sprache ermög-
lichen es, von einer Wirklichkeitsdimension zu sprechen, die nicht direkt benennbar
und abbildbar ist. Religiöse Deutung ist, weil sie den gewohnten Alltag überschrei-
tet, immer ein vorsichtiges Tasten - im Wissen, dass keine Beschreibung dem zu Be-
schreibenden im Letzten angemessen ist.
Jede Religion bezieht sich auf ein besonderes Erleben der Wirklichkeit und deutet
dieses auf ihre Weise religiös. So haben sich in der Menschheitsgeschichte unter-
schiedliche Traditionsströme herausgebildet. Einer dieser religiösen Traditionsströ-
me ist das Christentum.
Der in aller Kürze vorgestellte liberaltheologische Ansatz scheint mir für die heutige
Zeit sehr hilfreich zu sein. Er ermöglicht es,
- Religion als Phänomen eigener Art plausibel zu machen,
- ihre besondere Sprache einzuordnen
- und die Eigenheit des Christentums darzustellen, ohne andere Religionen herabzu-
würdigen.
Liberale Theologie geht vom Menschen und seiner Welterkundung und Selbstdeu-
tung aus - wie es die Naturwissenschaften auch tun. Sie entspricht damit moderner
Denkart. Traditionelle Theologien nehmen hingegen nicht mehr hinterfragbare Set-
zung vor, mit denen man einverstanden sein muss (z.B. die Existenz Gottes oder ge-
offenbarte Wahrheiten). Darauf lassen sich - so ist meine Wahrnehmung - immer
weniger Menschen ein. Noch weiter entfernt von einem liberaltheologischen Ansatz
sind evangelikal-fundamentalistische Positionen. Sie wollen letztlich hinter die Auf-
klärung zurück. Darauf kann sich ein Protestantismus, der auf der Höhe der Zeit sein
will, nicht einlassen.
F) Vorschlag für einen inhaltlichen Aufriss
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von einem liberaltheologischen Ansatz her
zentrale Dimensionen des christlichen Glaubens zu erschließen. Im Folgenden stelle
ich eine Möglichkeit vor. Diese sieht vor, ein modernes Glaubensbekenntnis entlang
der Person Jesus von Nazareth zu entfalten. Immerhin ist es sein Ehrentitel "Chris-
tus", von dem wir unsere Selbstbezeichnung "Christen" ableiten.
1) Jesu Verkündigung
Ich würde ein neues Glaubensbekenntnis mit Jesu Verkündigung beginnen lassen.
Ihm, Jesus, ging es um eine besondere Weise, die Welt anzusehen und zu verstehen.
An ihr haben Menschen teil, wenn sie sich wahrnehmen als Teil eines großen Gan-
zen und eine intensive Verbundenheit mit der ganzen Welt empfinden. Wenn sie
ihre Mitmenschen nicht mehr als Konkurrenten betrachten, sondern als Geschwis-
ter, die Natur nicht mehr als Verfügungsmasse, sondern als kostbare Lebensgrund-
lage. Mit der Mitwelt im Einklang zu leben, sich zu erfreuen an der Fülle des Lebens
und zugleich zufrieden zu sein mit dem, was man wirklich zum Leben braucht: Das
bedeutet nach Jesus höchstes Lebensglück und größter Lebensgenuss.
Diese antirassistische und antimaterialistische Sicht Jesu auf die Welt und das Leben
ist meines Erachtens einer der wesentlichen Bestandteile für den christlichen Glau-
ben, gerade in der heutigen konsumorientierten Konkurrenzgesellschaft.
Eventuell könnte man an dieser Stelle des Glaubensbekenntnisses als Problem be-
nennen, dass Jesus von den Evangelisten auch Worte in den Mund gelegt wurden,
die sich auf Situationen und Konflikte späterer Zeit beziehen. Und darauf hinweisen,
dass die Bestimmung echter Jesusworte nie eindeutig sein wird.
2) Jesu Gottesglaube
Ich würde anschließend deutlich machen, dass Jesus seine Sicht der Wirklichkeit auf
dem Hintergrund einer religiösen Tiefenerfahrung entwickelte - und damit auf das
Thema "Gott" zu sprechen kommen. Gott, das ist in der Bibel der Name, die Chiffre
für das von mir oben beschriebene besondere Erleben der Wirklichkeit und der reli-
giöse Deutung ihrer als Teil eines größeren Ganzen. Die Israeliten verbanden diesen
Namen mit den hellen, erfolgreichen Momenten ihrer wechselvollen Geschichte -
Erfahrungen des Vertrauens, der Befreiung, der Gerechtigkeit - ebenso wie mit Dun-
kel und Selbstzweifel. Ihre Erfahrungen verarbeiteten sie in den Büchern der Bibel zu
einer großen Geschichte, die vom Anfang der Welt bis zu ihrer erwarteten Vollen-
dung reicht. Jesus lebte in diesem jüdischen Glauben. Er fühlte sich in Gott unend-
lich geborgen. Diese Resonanzerfahrung hat ihn sein Leben lang getragen. Weil er
sich im Einklang mit dem größeren Ganzen "Gott" wusste, war es ihm wichtig, auch
im Einklang mit seiner Mitwelt zu sein. Deshalb hat er seine Sicht der Wirklichkeit
auch "Reich Gottes" genannt.
An dieser Stelle würde ich als Problem skizzieren, dass sich im Judentum personale
Gottesvorstellungen durchgesetzt und ein immer größeres Eigenleben entwickelt
haben bis hin zur Aufforderung Gottes zu Krieg und Zerstörung. Ich würde als Auf-
gabe von uns Christen heute benennen, diese menschlich-allzumenschlichen Got-
tesvorstellungen kritisch zu hinterfragen und neue Zugänge, Gedanken und Vorstel-
lungen über Gott zu entwickeln.
3) Jesu Leben und Sterben
Anschließend würde ich mit Jesus fortfahren und kurz auf sein Wirken eingehen:
Dass ihm vor allem die Menschen am Herzen lagen, die sich von allen verlassen fühl-
ten. Dass er eine ungeheure Ausstrahlung gehabt haben muss. Und er authentisch
war, weil er lebte, was er sagte.
Dass er dann schließlich in die Mühlen der Macht geriet, aber sich nicht wehrte,
sondern seinem Weg der radikalen, uneingeschränkten Liebe bis zur letzten Konse-
quenz treu blieb. Am Ende stirbt er qualvoll am Kreuz.
Die paulinische Kreuzestheologie, also die Vorstellung, dass er starb, um uns von
unseren Sünden zu erlösen, würde ich nicht thematisieren. Mich hat diese Deutung
des Todes Jesu nie überzeugt, zumal sie von einer personalen Gottesvorstellung
ausgeht, die besagt, dass Gott seinen Sohn willentlich opfert bzw. sein Opfer willent-
lich annimmt.
Stattdessen würde ich an dieser Stelle die Hoffnung Jesu zur Sprache bringen, auch
nach dem Tod bei bzw. in Gott geborgen zu sein. Dabei greift Jesus auf alttestament-
liche Jenseitsvorstellungen zurück. Was wir traditionell mit den Worten "ewiges Le-
ben" beschreiben, bringt genau die Hoffnung auf ein Sein bei bzw. in Gott auch nach
dem Tod zum Ausdruck.
4) Jesu Auferstehung
Anschließend ist dann zur Sprache zu bringen, dass Jesu Ende ist noch nicht das En-
de war, sondern es in gewisser Weise jetzt erst richtig losging. Aus den Auferste-
hungserzählungen erfahren wir, dass die Freunde Jesu ihn überraschenderweise
nach seinem Tod gegenwärtig erleben in Worten und Handlungen, die für ihn ty-
pisch waren und sie mit ihm verbinden. Sie beschließen, seine Reich-Gottes-Sicht
der Welt weiterzutragen und entsprechend zu leben und zu handeln. Ihn, Jesus, wis-
sen sie in ihrer Mitte: als erlebbare Dynamik, die ihnen Flügel verleiht. »Heiliger
Geist« nennen die Evangelisten diese Art der Gegenwart Jesu.
5) Die Kirche als Nachfolgeorganisation Jesu
Nun ist auf die Entstehung der Kirche einzugehen: Die Freunde setzen ihr Vorhaben
um, im Sinne Jesu weiterzumachen. Bald stoßen immer mehr zu ihnen – im weiteren
Verlauf auch Menschen, die keine Juden sind: So entsteht die Kirche als eine große
Bewegung.
An dieser Stelle kommt man nicht umhin, einzugestehen, dass die Kirche ihrer Auf-
gabe in der Geschichte immer wieder untreu geworden und sich stattdessen mit den
Mächtigen der Welt eingelassen hat. Ich würde klar zum Ausdruck bringen, dass Kir-
che hat nur dann eine Chance in der Zukunft hat, wenn sie sich auf ihre Identität
wieder zurückbesinnt. Ein lebendige Überzeugungsgemeinschaft, die im Sinne Jesu
aktiv ist, die im Austausch steht mit Wissenschaft und Religionen und die Nöte und
Sorgen der Menschen in den Blick nimmt: Das wäre meines Erachtens auch in der
heutigen Welt hochattraktiv.
6) spätere Übermalungen Jesu
Abschließend könnte man noch spätere Ausmalungen des Lebens Jesu erwähnen: Es
wurden ihm Wundergeschichten angehängt und man hat ihm Ehrentitel beigelegt
(Menschensohn, Messias, Sohn Gottes). Aber damit nicht genug: Die Evangelisten
malten das Gefühl der Gegenwart Jesu, das die Freunde nach seinem Tod hatten,
mit bunten Farben aus und erweckten damit den Anschein, dass sein leibliches Le-
ben nach dem Tod weiterging, als hätte man einen Leichnam wiederbelebt. Lukas
erzählte schließlich sogar von seiner Himmelfahrt: Ausdruck dessen, dass Jesu Karri-
ere als Himmelswesen steil nach oben ging. In dieser Linie denkt auch der Apostel
Paulus, der Tod und Auferstehung Jesu zu einer großangelegten Erlösungslehre aus-
baute.
Ich würde klar zum Ausdruck bringen, dass diese Übermalungen Jesu zur Folge hat-
ten, dass seine Verkündigung immer mehr in den Hintergrund trat. Eine Entwick-
lung, über die Jesus selbst sicherlich am traurigsten gewesen wäre.
Abschluss
Was ich als inhaltliche Ideen für neue Glaubensbekenntnisse präsentiert habe, ist
meine persönliche Sicht der Dinge. Andere mögen es anders sehen. Wichtig wäre
mir, dass wir Christen uns endlich trauen, offen und ungeschminkt über unseren
Glauben zu debattieren und dabei auch einmal Gewohntes und Selbstverständliches
in Frage zu stellen. Damals auf den Konzilien der Alten Kirche hatte man noch über
Glaubensthemen gestritten. Diese Diskussionskultur ist uns in der Kirche schon seit
längerem abhanden gekommen. Ich bin sicher: Wenn wir uns wieder trauen wür-
den, ganz grundsätzlich über Glaubensthemen zu diskutieren, würde das Leben in
die Kirche bringen. Und vielleicht auch Auswirkungen haben nach außen.
Sich zurückzuziehen auf Bekenntnisse, die Menschen vor 1700 Jahren ersonnen ha-
ben: Das kann jedenfalls keine Alternative sein. Das Alte kennen die Menschen zur
Genüge - und wollen es nicht mehr hören. Jesus hat einmal gesagt: "Neuer Wein in
neue Schläuche". Jetzt wo unsere alten Schläuche immer mehr brüchig geworden
sind, wäre die Zeit vielleicht doch irgendwann mal reif für Neues. Neue Glaubensbe-
kenntnisse, die entstehen, könnten Ausdruck dafür sein, dass sich die Kirche noch
einmal neu auf den Weg macht.