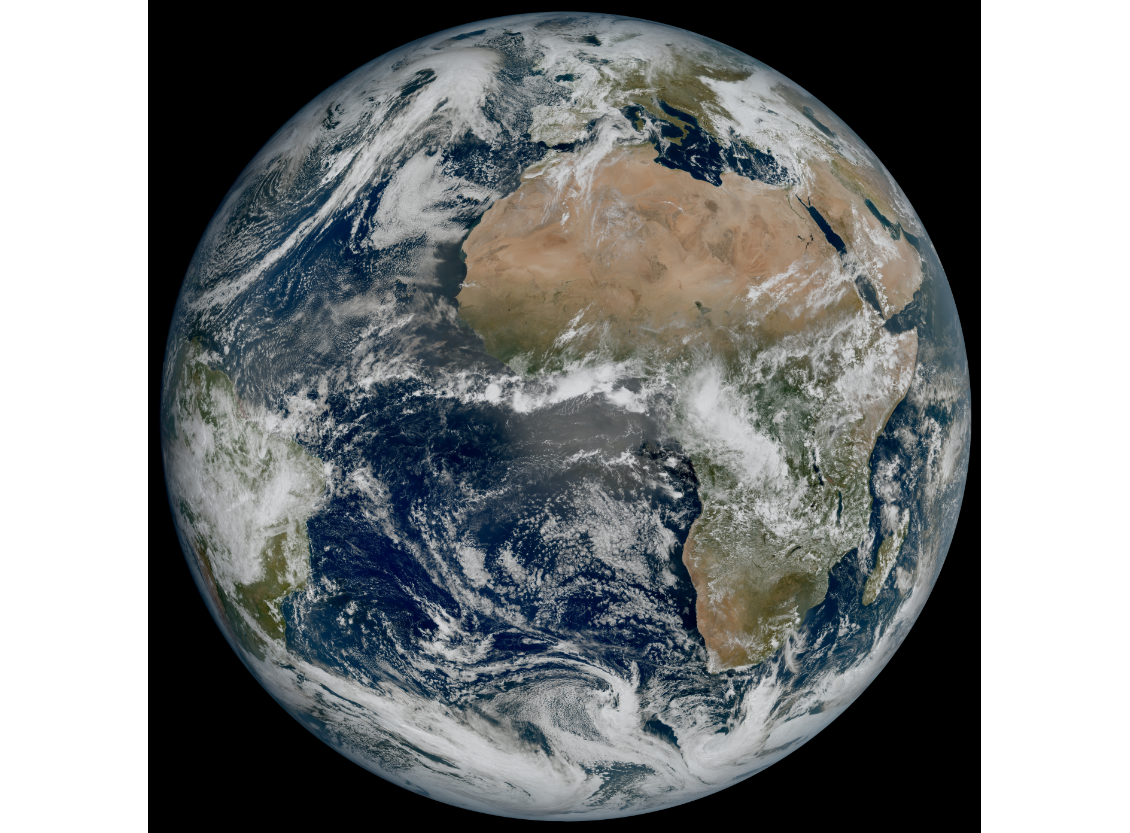Der persönliche Gott innen
von Prof. Dr. Helmut Kinder
Einleitung
Religion ist ein Phänomen, das in allen Kulturen anzutreffen ist. In jeder Religion werden gewisse sprachliche Bilder verwendet, um die Glaubensinhalte zu kommunizieren. Diese Sprache verwendet als Metaphern Begriffe aus dem jeweiligen Menschenbild und dem jeweiligen Weltbild. Dies ist der sog. Kontext einer Religion. Während sich aber Menschenbild und Welterkenntnis Im Laufe der zeitlichen Entwicklung ändern, wird der Kontext einer Religion meist beibehalten in dem Bestreben, keinesfalls die Glaubensinhalte zu verlieren, die ja durch diese alten Begriffe beschrieben sind, d. h. die Religionsgemeinschaft stemmt sich konservativ gegen neue Welterkenntnis. So entsteht mit der Zeit ein immer größerer Widerspruch zwischen dem Stand der Wissenschaft und der Sprache der Religion.
Besonders im Westen wurde dieser Widerspruch durch die großen Fortschritte der Naturwissenschaften immer deutlicher, sodass heutzutage besonders im christlichen Abendland ein Großteil der Bevölkerung mit dem Christentum nicht mehr viel anfangen kann. Das Fehlen einer anerkannten Religion führt dann zu einer Mischung aus Atheismus und Ersatzreligionen, wie z.B. der Glaube an Schutzengel und Geister oder auch zu einem einseitigen Aktivismus für extrem linke oder extrem rechte Politik, für Vögel, Wölfe oder Bären. Und die Askese wird ersetzt durch vegane Ernährung.
Im Islam ist dagegen die Neuzeit noch nicht im gleichen Maße angekommen, der Widerspruch ist noch nicht so deutlich. Entsprechend haben Muslime, nicht nur die Extremisten, meist eine viel größere Glaubensgewissheit als „normale“ (d.h. nicht evangelikale) Christen. Das beunruhigt viele im Westen. In jüngster Zeit entwickelt sich daraus eine lebhafte Diskussion, was Religion im Allgemeinen und „Gott“ oder „das Göttliche“ im Besonderen sei, und ob das nicht doch etwas ist, das uns alle angeht. Mit dieser Frage habe ich mich mein Leben lang befasst.
Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wurde aber mit 17 Jahren Atheist, weil ich sah, dass jede Religion behauptete, die einzig wahre zu sein. Also war darauf kein Verlass. Ich studierte dann Physik mit Mathematik und Chemie, und entfremdete mich so immer weiter vom Christentum. Trotzdem, in schwierigen oder verzweifelten Situationen „ertappte“ ich mich dabei, dass ich betete! Und dass mir das Beten half! Obwohl ich nicht mehr an einen Gott glaubte, hatte ich offenbar immer noch eine Art unbewusste Gottesbeziehung. Also musste da doch irgendetwas sein. Als Physiker wollte ich aber nicht „glauben müssen“, sondern wissen und verstehen, was da war.
Zufällig las ich dann, dass C. G. Jung gefragt wurde, ob er an Gott glaube. Er antwortete, dass er nicht glaube, sondern wisse.[1] Ich habe dann viele von Jungs Schriften gelesen und traf auf seinen Ausspruch: „Gott ist die stärkste Kraft im kollektiven Unbewussten.“ Und ich las Ludwig Feuerbach, der Gott als das „Wesen des Menschen“ beschrieben hatte. Offenbar war es gar nicht nötig, an eine übernatürliche und nebulöse „Transzendenz“ zu glauben, sondern es handelte sich um etwas ganz Reales in uns Menschen.
Und das konnte auch der Grund sein, warum Religion in allen Kulturen vorkommt und warum viele Menschen daran festhalten, auch wenn das nicht in Einklang mit ihrem gegenwärtigen Weltverständnis steht. Es gilt also, die Sprache der Religion von ihrem archaischen Kontext zu befreien und zu ihrer Kernbotschaft vorzudringen. Dazu möchte ich hier einen Beitrag leisten. Dabei gehe ich hauptsächlich auf das Christentum ein, da dies meiner eigenen Erfahrung entspricht.
Der Schöpfergott außen und das heutige Weltbild
Zuerst geht es darum, den Widerspruch zwischen dem traditionellen Kontext der christlichen Religion und dem heutigen Weltverständnis darzustellen.
Gott wird im traditionellen Christentum und in der christlichen Philosophie durch gewisse idealisierte Eigenschaften beschrieben: Er ist ein personales Wesen, das allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ewig, gütig und menschenliebend ist. Dieses Wesen ist kein Teil der materiellen Welt, sondern steht dieser in einer „Transzendenz“ gegenüber. In seiner Allmacht hat er als Schöpfer die Entstehung und Entwicklung des Universums veranlasst und ist seither die „alles bestimmende Wirklichkeit“.[2],[3]
Wenn man dies alles wörtlich und als Tatsachen nehmen will, kommt man sofort in Widersprüche. Beispielsweise kann der Mensch sich selbst töten. Ein Wesen, das ewig ist, kann das nicht, sonst wäre es ja vergänglich. Also kann es nicht alles. Die Eigenschaften „ewig“ und „allmächtig“ sind nicht kompatibel.
Ein allwissendes Wesen enthält die Information des ganzen Universums. Ein solches Wesen kann nicht Schöpfer der Welt sein. Denn es kann nichts Neues hervorbringen, weil es ja alles bereits selbst enthält. Vielmehr müsste man dann weiter zurück fragen nach dem Ursprung dieser ganzen Information, also nach dem Schöpfer des allwissenden Wesens.
Ein allgegenwärtiges Wesen ist im ganzen Universum anzutreffen. Das Universum ist aber nach heutiger Kenntnis riesengroß. Es ist im Durchmesser 8x1014 (also eine 8 mit 14 Nullen) mal größer als unser Sonnensystem (Asteroidengürtel), 7x1019 mal größer als unsere Erde und 2x1026 mal größer als wir Menschen. Gott wäre also unvorstellbar groß, und demnach sein Sohn, der Mensch Jesus Christus, nur eine winzige Missgeburt. Dass sich ein so großer Gott angeblich einer so kleinen Restmenge liebevoll zuwendet, ist absurd. Mehr noch, es ist Selbstüberschätzung des Menschen.
Nicht nur der Lebensraum Erde des Menschen ist winzig, auch die Zeitspanne, die er dort verbringen darf. Die ersten Menschen erschienen erst vor 2 Mio. Jahren auf der Weltbühne, die damals schon 13.800 Mio. Jahre alt war. Und er wird auch nicht lange bleiben, denn die Erde verliert ständig Energie durch die Gezeiten und nähert sich unaufhaltsam der Sonne, bis alles Wasser verdunstet. Spätestens in 200 Mio. Jahren wird daher alles Leben auf der Erde absterben.[4] Also wären wir für diesen ewigen Gott nur eine kurzfristige Spielerei.
Dass es sich bei diesen riesigen Dimensionen und ewigen Zeitspannen um ein „personales“ Wesen handeln soll, ist eine allzu menschliche Vorstellung. Schon der Vorsokratiker Xenophanes, der in Afrika gereist war und gesehen hatte, dass dort nicht nur die Menschen, sondern auch die Götter schwarz waren, sagte: „Wenn wir Pferde wären, wären auch unsere Götter Pferde.“ Also der Mensch macht sich seine Gottesvorstellung nach seinem eigenen Bilde, nicht umgekehrt. Besonders berühmt ist Michelangelos Bild mit dem Schöpfergott als alter weißer Mann in der Sixtinischen Kapelle.
Auch wäre dieser Gott keineswegs immer gütig und liebevoll zu den Menschen, denn er lässt ja Tsunamis und Hurrikans, den Holocaust, Hiroshima und die schrecklichen Kriege der Menschheit zu (also besonders die „physischen Übel“ nach Leibnitz). Dieses Theodizee-Problem ist auch unter Theologen nach wie vor ungelöst.[5] Es ist klar: wenn dieser Gott allmächtig und gütig zu uns Menschen wäre, sähe die gegenwärtige Welt ganz anders aus.
Und sollte ein solches Wesen dennoch unsere ganze Wirklichkeit bestimmen, so ließ sich dessen Wirken bisher jedenfalls nicht nachweisen. Im Gegenteil, die Physik kommt ganz ohne diese Hypothese aus. So bereits Laplace gegenüber Napoleon: „Je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse“.[6]
In der heutigen Physik ist das ganz selbstverständlich, auch für Quantenphysik und Allgemeine Relativitätstheorie. Letztere besagt sogar, dass es überhaupt keinen Schöpfer des Universums geben kann, denn die Zeit ist erst im Urknall entstanden. Ohne Zeit gibt es überrhaupt kein „vorher“. Das können wir uns nicht anschaulich vorstellen, aber es ist logisch zwingend: Dem Urknall ging zeitlich nichts voraus, keine Ursache, kein Schöpfergott.
Nun wird eingewendet, Gott sei nicht mit menschlichen Maßstäben zu messen. Ein „überirdisches“ oder „übersinnliches“, also übernatürliches Wesen könne trotzdem alle diese Eigenschaften gleichzeitig besitzen. Dazu muss jedoch der Begriff „übernatürlich“ kritisch beleuchtet werden:
Übernatürliches kann per Definition keinerlei Wechselwirkung mit der physikalischen Welt haben. Denn gäbe es eine solche Wechselwirkung, so würde sich diese im Prinzip mit physikalischen Mitteln nachweisen lassen. Genau das aber würde bedeuten, dass das angeblich Übernatürliche tatsächlich ein Teil der physikalischen Welt wäre, also gerade nichts Übernatürliches. Aus demselben Grund haben auch sonstige „geistige Parallelwelten“, von denen man bisweilen hört, keinerlei Wechselwirkung mit unserer physikalischen Welt.
Da es also keine Wechselwirkung zwischen der physikalischen Welt und einer übernatürlichen Welt geben kann, können wir auch auf keine Weise nachprüfen, ob diese existiert. Es ist also eine Hypothese, die prinzipiell nicht falsifizierbar ist (K. Popper). Solche Hypothesen sind überflüssig und zu eliminieren (Ockhams „Rasiermesser“), denn sie sind reine Gedankenkonstrukte. So auch Kant über den Unterschied zwischen 100 gedachten und 100 echten Talern. Mangels Wechselwirkung hätte dieses Übernatürliche auch keinerlei Einfluss auf unser Dasein. Wir können es ignorieren.
Die philosophischen Vorstellungen von einem übernatürlichen Gott, der die Welt erschaffen hat und deren Wirklichkeit bestimmt, sind also offensichtlich widersprüchlich und können nicht als Tatsachen gewertet werden, noch nicht einmal als vernünftige Hypothese. So wird verständlich, dass alle „Gottesbeweise“ scheitern mussten (Kant).
Aus dieser Einsicht heraus wird nun mancherorts versucht, Gott philosophisch in die Welt zurückzubringen und „holistisch“[7] oder „pan-en-theistisch“[8] „neu zu denken“. Doch auch dieser Versuch, „den Glauben mit den Naturwissenschaften auszusöhnen“, versöhnt im Gegenzug keineswegs die Wissenschaftler mit dem Glauben.
Denn für diese besteht die Welt letztlich aus Energie. Auch Materie ist eine Erscheinungsform der Energie gemäß Einsteins E=mc². Wer nun sagt, „die Welt, das ist ja Gott“[9] oder auch „alles ist Geist“[10], der behauptet, wie schon Spinoza, dass alles letztlich aus ein und demselben Stoff besteht. Er ist also Monist. Ob er diesen einen Stoff nun „Gott“ oder „Geist“ oder eben „Energie“ nennt, das ist nur eine Frage der Bezeichnung, denn es ist ja jedesmal derselbe Stoff.
Auch wir selbst bestehen aus diesem Stoff, denn wir sind ja Teil des Universums. Das zu wissen macht uns bescheiden und demütig. Aber der Stoff selber, nennen wir ihn Gott oder Geist oder Energie, ist dann nichts Heiliges, sondern eine Banalität. Ich werde aber weiter unten im Abschnitt „Projektion“ darauf zurückkommen.
Schließlich sind noch die Berichte in den Evangelien zu erwähnen: Jungfrauengeburt, Engel, Wunder, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Als Tatsachen können diese heutzutage nicht mehr gelten, denn sie widersprechen jeglicher wissenschaftlichen Erkenntnis. „Verdummbibelung“ nennt das die Jugendsprache. Die archaische Sprache versperrt den Zugang zum Glauben.
Der persönliche Gott innen und die Mystik
Aber warum hat die Menschheit dann überhaupt solche Vorstellungen entwickelt, warum haben diese eine derart weite Verbreitung gefunden und sich so lange halten können? Offenbar steht dahinter eine menschliche Erfahrung, die sich zwar nicht direkt in Worte fassen lässt, die aber durch diese Vorstellungen und Begriffe bzw. Metaphern, kommunizierbar und vor allem auch nachvollziehbar wurde. Allerdings verlieren diese Vorstellungen in der Neuzeit immer mehr an Überzeugungskraft, weil sie in einem archaischen Kontext stehen. Nur dieser Kontext ist überholt, nicht aber die dahinter stehende Erfahrung.
Bereits Dietrich Bonhoeffer hat sich intensiv mit diesem Problem befasst. Er nannte den traditionellen Schöpfergott einen „Lückenbüßer für unser Nichtwissen“,[11] den wir mit Erweiterung unseres Wissensstandes immer weiter von uns wegschieben müssen und folgerte: „Einen Gott, den es [da draußen angeblich] gibt, den gibt es nicht.“[12] Das gehört zur intellektuellen Redlichkeit. Aber die dahinter stehende menschliche Erfahrung beschrieb er so: „Der Gott, der uns in der Welt leben läßt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen.“[13]
Der traditionelle Schöpfergott ist in die Ferne gerückt, ist überholt, aber die Erfahrung, vor einem Gegenüber zu stehen, das man zwar nicht sieht aber spürt, die ist real. Auch Muslime kennen diese Erfahrung, „direkt vor Gott zu stehen“. Gerade deshalb lehnen sie ja Jesus als Mittler zwischen Gott und Mensch ab. Doch „denkt“ sich auch der offizielle Islam Gott noch „da außen“. Anders allerdings die Sufis und auch die Aleviten.
Offenbar ist Gott für betende Menschen ganz nah, sie können ihn spüren, als stünden sie vor ihm. Auch mir geht das so. Aber wenn er tatsächlich vor uns stünde, könnten wir ihn sehen oder wenigstens irgendwie sonst nachweisen. Das ist nicht der Fall. Also beruht dieses „Spüren“ nicht auf äußeren Sinneseindrücken, sondern muss von innen her kommen.
Dies sagte auch Jesus selber zu den Pharisäern: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; man wird auch nicht sagen: Siehe hier! oder: da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.[14]
Diese Erkenntnis wurde durch die zwei Jahrtausende von vielen Mystikern weiter getragen, und sie fand auch ihren Niederschlag in der Lehre von der Gestalt Gottes als Heiliger Geist, der im Pfingstgeschehen über die Jünger kam und seither im Herzen der Gläubigen wohnt.
Wenn aber Gott „inwendig in uns“ ist, so hat das nichts mit der Kosmologie zu tun oder mit einem „Jenseits“, sondern nur mit uns Menschen. Aber wir selbst sind nicht Gott. Vielmehr empfinden wir ihn als eine Art personales Gegenüber in uns; „ewiges Du“ nennt das Martin Buber,[15] „das ganz Andere“ Rudolf Bultmann2 und „Gegenüber des Glaubens“ Wilfried Härle.[16]
Dann ist er zwar nicht allgegenwärtig, aber wir nehmen ihn überall mit hin. Für jeden von uns ist er deshalb stets gegenwärtig. „Ich weiß, dass einer mit mir geht“ dichtete Hanns Köbler.[17] Auch wird klar, dass wir ihm nicht entfliehen können, wie in den Erzählungen über Adam, Kain und besonders Jona dargestellt. Dann ist er zwar nicht ewig, aber er begleitet jeden von uns, jeden Tag, ein Leben lang.
Dann ist er auch nicht „allmächtig“, denn in der Außenwelt ist er überhaupt nicht vorhanden. Sondern er bestimmt unsere innere Wirklichkeit. Er hilft uns nicht in der Welt draußen, aber er stützt uns von innen und gibt uns eine ganz neue Einstellung und Kraft zum Leben. „Gottvertrauen“ nennen wir das oft. Und er „erlöst“ uns von unserer Ich-Bezogenheit, öffnet unseren Blick für die Mitmenschen und lässt uns die Welt mit anderen Augen sehen. „Die Welt mit Gottes Augen sehen“, sagte Dorothee Sölle.[18]
Damit ist auch das Theodizee-Problem gelöst. Dazu Sölle mit Hinweis auf Teresa von Avila: „Gott hat keine anderen Hände als unsere.“[19] Den Auftrag der Güte und Zuwendung zu unseren Mitmenschen gibt er an uns weiter, den Auftrag zur Mitmenschlichkeit. Das ist Jesu Botschaft von der Nächstenliebe.
Er ist dann auch nicht allwissend, aber er kennt unsere Gedanken von innen. Und er gibt uns seine Gedanken ein, wenn wir nach innen auf ihn hören, uns für seinen Einfluss öffnen.
Er ist auch nicht der Schöpfer der physikalischen Welt „da draußen“, sondern wir empfinden ihn als „Basis“, oder „Urgrund“ unseres eigenen Seins, unserer Innenwelt.
Informationen über die Außenwelt erfahren wir ja nur durch unsere Sinnesorgane. Aus diesen Informationen entsteht im Kopf ein Bild der Außenwelt. Dieses Bild im Kopf ist also Teil unserer Innenwelt, deren Basis Gott ist. Darum empfinden wir Gott als den Schöpfer. Er ist für uns der „gefühlte Schöpfer“, so wie wir auch von einer „gefühlten Temperatur“ reden.
Nun können wir auch die Wundergeschichten der Bibel einordnen: als Erzählungen, als Bilder, mit denen unsere Vorfahren ihren Glauben ausdrückten. So sagt der auferstandene Christus von Mt. 28,20: „Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Und doch wird er in Apg. 1,9 in den Himmel entrückt. Aber das muss kein Widerspruch sein: wenn Christus als Gegenwart Gottes in uns aufersteht, haben wir den Himmel im Herzen!
Wir sehen, dass die alte Sprache die menschlichen Empfindungen damals gut abgebildet hat. Wir brauchen sie nur ein wenig umzudeuten, um in heutiger Sprache dieselben Empfindungen zu beschreiben. Offenbar hat die alte Sprache dieses innere Erleben so in die Außenwelt projiziert, dass die dahinter stehende Erfahrung leicht herausgespürt und nachvollzogen werden konnte. So erklärt sich auch die weite Verbreitung des Christentums über alle Sprachgrenzen hinweg. Aber natürlich auch die der anderen Weltreligionen.
Was sind also diese Empfindungen? Dazu müssen wir verstehen, wie unser Gehirn arbeitet.
Der Mensch
Objektiv gesehen denkt der Mensch mit dem Gehirn. Im Gehirn befinden sich verschiedene Areale mit spezialisierten Funktionen, die zum größten Teil unbewusst ablaufen.[20] Die einzelnen Schaltelemente des Gehirns sind die ca. 100 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen. Von diesen gehen Axone aus, die jeweils rund 1000 Synapsen tragen. Diese können Botenstoffe, sog. Neurotransmitter, ausschütten, die andere Nervenzellen erregen. Alle Nervenzellen zusammen bilden ein stark wechselwirkendes Netzwerk, das insgesamt eine Art „Schwarm-Intelligenz“ hervorbringt. Der Gehirnforscher Gerhard Roth bezeichnete das Gehirn als einen „chemischen Computer“.[21]
Inzwischen gibt es ein gigantisches Europa-Projekt, das dieses Netzwerk, also unsere menschliche Intelligenz, auf einem Rechner-Cluster nachbilden soll, das „Human Brain Project.“[22] Inzwischen ist auch die künstliche Intelligenz in Mode gekommen, aber verglichen mit unserem Gehirn kann sie noch fast gar nichts.
Dies ist der Mensch objektiv von außen gesehen, ein wenig gruselig, aber so ist es nun mal. Aber für die Spiritualität des Menschen ist das eigenlich völlig nebensächlich. Soll es doch in fernerer Zukunft „fromme“ Roboter geben. Wenigstens lassen die uns dann noch leben. Hier interessiert uns nicht die Sicht von außen auf unser Gehirn, sondern in erster Linie die Sicht von innen, auf das von uns selbst empfundene Innenleben.
Was wir da erleben, ist, dass unser Bewusstsein nur einen kleinen Teil unserer gesamten Gehirntätigkeit ausmacht. Der weitaus überwiegende Teil vollzieht sich unbewusst. Es wäre auch wenig ökonomisch, wenn wir jeden Click jeder einzelnen Nervenzelle registrieren sollten. Die unbewusste Gehirntätigkeit erfasst die gesamten im Gehirn gespeicherten Daten, ins Bewusstsein dringt aber nur das Endergebnis einer hochgradigen Datenreduktion. Nur dieses Ergebnis ist für unser Überleben wichtig.
Die unbewusste Gehirntätigkeit verrät sich hier und da in unserer Sprache, z. B. wenn wir ein Problem haben, und uns am nächsten Morgen eine Lösung dafür „einfällt“. Von woher „fällt“ sie? Sie ist doch wohl ein Resultat unserer unbewussten Gehirntätigkeit während wir schliefen. „Das hat im Hinterkopf gearbeitet“ sagen wir dann.
Auch reden wir vom „Bauchgefühl“ wenn wir uns in einer Sache entscheiden, aber diese Entscheidung nicht rational begründen können. Wieder ein Resultat unbewusster Gehirntätigkeit. Bei einfachen Entscheidungen lässt sich diese Gehirntätigkeit sogar experimentell messen an Hand des sie begleitenden Aktionspotentials im EEG, das sich bereits aufbaut, bevor der Person die Entscheidung ins Bewusstsein dringt. Diese Vorlaufzeit kann bis zu 10 Sekunden betragen.[23]
Das Bewusstsein ist also, im Bild des Computers gesprochen, der Monitor, auf dem die bereits verarbeitete Information als zusammengefasstes Ergebnis erscheint. Dieses Resultat beeinflusst dann unser weiteres Verhalten. Oder auch so: das Bewusstsein ist nur die App, die auf dem mächtigeren unbewussten Betriebsystem läuft.
Das Unbewusste wurde wohl erstmals von Sigmund Freud beschrieben. Er stellte das Ich zwischen Über-Ich und Es als die beiden Hauptantriebe des Menschen.[24] Einen Gott lehnte er strikt ab. Aber merkwürdigerweise hat sein Über-Ich genau die strengen Wesenszüge, die in Freuds Judentum Gott zugeschrieben werden. Er lehnte also nur den „Gott außen“ ab und setzte das Über-Ich an dessen Stelle. Nicht mehr als externes Wesen, sondern als innere psychische Kraft, eben unser „Betriebsystem“.
Nehmen wir nun die Erkenntnis Jesu hinzu, dass Gott nicht streng und strafend ist sondern vielmehr positiv fördernd und unterstützend wie ein guter Vater, so können wir diese Erkenntnis auf das Über-Ich übertragen und haben ziemlich genau das, was ich mit „Gott innen“ meine. Dies geht auf C.G. Jung zurück:
Der Pfarrerssohn C. G. Jung vertiefte die Vorstellungen vom Unbewussten, indem er zwischen einem individuellen, persönlichen Teil und einem kollektiven Teil desselben unterschied. Im individuellen Teil befinden sich vergessene und verdrängte Inhalte des jeweiligen Menschen, während sich im kollektiven Teil die „Archetypen“ befinden. Dies sind durch die Evolution erworbene, angeborene Inhalte, die in jedem Menschen tief im Innern als autonome psychische Faktoren wirksam sind. Sie können als Bilder im Traum erscheinen und finden sich in allen Kulturen wieder, wie Jung in seinen Untersuchungen nachwies. Auch viele Volksmärchen und Mythen sind Ausdruck dieser Archetypen.
Jung identifizierte nun Gott mit dem wirksamsten unter diesen Archetypen, dem „König“, also der stärksten Kraft im kollektiven Unbewussten.[25] Gott war für ihn also explizit ein in jedem Menschen real existierender psychischer „Faktor“, der auf unser Bewusstsein und unser Verhalten einwirkt. Dieser Faktor ist autonom in dem Sinne, dass er Signale in unser Bewusstsein sendet, wir aber vom Bewusstsein her keinen Einfluss auf ihn haben.
Dies deckt sich mit Schleiermachers Rede vom „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit.“[26] Die heutige Gehirnforschung identifiziert das "Woher" dieses Gefühls mit dem Limbischen System des Menschen.[27]
Der Mensch neigt aber dazu, alle Signale, die ins Bewusstsein dringen, so zu interpretieren als kämen sie von seinen Sinnesorganen, also nur von außen. So interpretiert er auch das Wirken der unbewussten Kräfte auf sein Bewusstsein als von außen kommende Mächte und personifiziert sie als göttliche Wesen. Ludwig Feuerbach erkannte als erster diesen Mechanismus, den Jung dann später „Projektion“ nannte.
Der Projektionsmechanismus
Vermittels des Projektionsmechanismus kann der Mensch das Empfinden haben, unmittelbar vor Gott zu stehen, so wie es Bonhoeffer beschrieben hat, siehe oben.13 Damit dieses innere Erleben realer wird, machten sich die Menschen seit jeher Götterfiguren und andere Symbole, die wirklich sichtbar sind.
Im vorderen Orient hatte vor 3000 Jahren jede Stadt und jedes Reich ihre Götterstatuen. Sogar Mose auf dem Horeb hatte den brennenden Busch als materielles Symbol angesehen. Als er zurückkam, tanzte sein Volk ums Goldene Kalb. Moses zweites Gebot, „du sollst dir kein Gottesbild machen“[28] wurde von den Israeliten später zwar beachtet, aber als materielles Symbol diente stattdessen die Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels.
Auch für Muslime gilt ein Bilderverbot. Doch auch sie haben ein allerheiligstes materielles Symbol, die Kaaba. Auf der Haddsch die Kaaba zu berühren ist das höchste Gut. Und wenn sie im normalen Leben beten, richten sie sich nach Mekka zur Kaaba hin aus.
Übrigens ist auch der Fuß der Petrusfigur im Vatikan schon ganz dünn geworden, weil alle Rompilger ihn anfassten; ich natürlich auch.
Die Christen in Ost und West haben kein Bilderverbot, trotz mancher Phase der Bilderstürmer. Mit diesen heiligen Figuren und Bildern und durch die dazu gehörigen Rituale – z. B. küssen die Orthodoxen die Ikonen – lassen sich die inneren Empfindungen assoziieren und machen es so leichter, sich zu öffnen und in sich hineinzuhören.
Doch das höchste Gut für die Christen sind ebenfalls materielle Symbole, nämlich Brot und Wein in der Kommunion. Der Vollzug der „Wandlung“, die in der katholischen Kirche sogar durch ein Glockenzeichen angezeigt wird, soll es uns erleichtern, dass wir unsere Empfindungen für Gott in der Gestalt Jesu Christi in diese Materie projizieren.
Welche Bedeutung dieser Vollzug hat, wurde im Abendmahlsstreit zwischen Luther und Zwingli deutlich. Ob nun Jesus tatsächlich in Brot und Wein gegenwärtig ist oder nur an ihn erinnert werden soll: Tatsächlich vollzieht sich die Wandlung ja nicht an der Materie, sondern in uns.
Die darauf folgende „Verinnerlichung“ von Brot und Wein macht uns dann besonders bewusst, dass wir diesen Gott in uns aufnehmen, dass wir ihn also erst außen und dann innen haben und ihn so wieder deutlich in uns spüren können.
Dagegen wird der Deutung der Kommunion als Sühnopfer, wie es Paulus sah, schon dadurch der Boden entzogen, dass diese Deutung einen „Gott außen“ voraussetzt, der in die Geschichte eingreift. Im Ergebnis unterstützt dies die Bestrebungen von K.P. Jörns.[29]
Eine Projektion, wenn auch auf höherer geistiger Stufe, ist natürlich auch der „Gott außen“ selber (s.o.). Er ist ein gedankliches Bild der Philosophen und Theologen, an dem sich unsere menschlichen Empfindungen assoziieren lassen. Beispielsweise sagte Anselm von Canterbury, Gott sei „etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.“[30]
Aber ein Gott, den man sich denkt, ist nicht der reale Gott, sondern nur das Bild, das man sich in Gedanken von ihm macht. So wie man sich von 100 gedachten Talern nichts kaufen kann, kommt auch von einem gedachten Gott keine Hilfe. Der wahre Gott kann nicht durch Denken erzeugt, sondern nur innerlich erfahren werden.
Diese innere Erfahrung kennen auch die Theologen, benennen sie aber als „Offenbarung“. Das Gedankenbild hat also – genau wie die materiellen Götterbilder – die Funktion, den „Gott innen“ zu assoziieren und besser begreiflich zu machen.
Verortet wird der gedachte Gott traditionell „im Himmel“ (Vaterunser) oder philosophischer in der „Transzendenz“. Aber auch dies sind Projektionen des menschlichen Unbewussten, keine realen Ortsbestimmungen. Gefühlt ist es natürlich trotzdem der „Himmel in uns“.
Auch die Ansätze, Gott philosophisch mit dem „Leben“ (Albert Schweitzer) oder mit dem ganzen Univesum (Spinoza) zu identifizieren, sind solche Projektionen.7,8 Wir empfinden dabei, dass wir mit allen Lebewesen über die Gene verwandt sind bzw. dass wir gleich allem anderen auf der Welt aus Materie bestehen. Gefühlt sind wir dann eine kleine Insel im großen Ozean (Romain Rolland), also „Teil des Ganzen“.
Die Gottesbeziehung im Gebet
Für Naturwissenschaftler ist es selbstverständlich, dass Bewusstsein, Unbewusstes und auch unsere inneren spirituellen Empfindungen auf Gehirnprozessen beruhen.
Experimente dazu hat Andrew Newberg mit Magnetresonanz-Tomografie ausgeführt.[31] Er legte Nonnen in die „Röhre“ und beobachtete ihr Gehirn während sie intensiv beteten. Ebenso beobachtete er buddhistische Mönche, während sie meditierten. Es war immer das gleiche Areal im Gehirn aktiv. Dies stellte sich später als das „Default-Zentrum“ heraus,[32] das Areal, das aktiv ist, wenn man „gar nichts denkt“.
Offenbar ist beim intensiven Beten das Ich abgeschaltet und „zerfließt" mit dem Unbewussten, die Sorgen und Ängste verschwinden, wir fühlen uns geborgen in etwas, das größer und stärker ist als wir selbst. „Ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in dir“ sagt Augustinus.[33] Wir nennen das dann Gottvertrauen, oder in höchster Intensität die mystische Vereinigung mit dem Göttlichen.[34]
Ich bete also nicht zu einem Schöpfergott, sondern mein Bewusstsein öffnet sich für die Signale einer stärkeren, mächtigeren Funktion der tieferen unbewussten Schichten in meinem Gehirn, die ich subjektiv den persönlichen Gott nenne, auch wenn sie objektiv limbisches System oder sonstwie heißen mögen. Mein Empfinden, Gott gegenüberzustehen und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein ist aber ganz unabhängig von diesen Benennungen. Ich könnte auch Allah oder Nirwana oder Tao sagen.
Es ist sowieso schwierig, innere Vorgänge in Worte zu fassen. Etty Hillesum gelingt es sehr eindringlich, wenn sie ihren Tagebüchern anvertraut:
"Wenn ich bete, führe ich oft einen verrückten oder kindlichen oder todernsten Dialog mit dem, was in mir das Allertiefste ist und das ich der Einfachheit halber als Gott bezeichne."[35]
So geht es mir selber auch, und ich kenne viele Menschen, denen es ebenso geht.
Das sind aber nicht nur Christen, sondern auch Muslime, Hindus und sogar Shinto-gläubige Japaner, auch wenn sie es „Allah“ oder „Nirwana“ oder „die Leere“ nennen. Und es gab schon immer in allen Religionen die Mystiker. Die Worte der jeweiligen Religionen, die Metaphern, sind verschieden. Aber die Empfindungen der Menschen sind gleich.
Wenn wir im Gebet Gott anrufen, bekommen wir oft auch so etwas wie eine Antwort: nicht explizit als gesprochene Worte, sondern als Gedanken, die uns über eine momentane Notlage hinausblicken lassen, die den engen Zirkel des Ich auflösen, die uns das Gefühl geben, in einem Größeren eingebettet zu sein und einen inneren Halt zu finden. Oft „fällt“ uns dann eine ganz einfache Lösung ein, an die wir vorher nicht dachten. In solchen Gedanken „redet Gott zu uns“.
Dann sagt er uns, was wir tun sollen. Nicht wir sollten ihn bitten, was er tun sollte, denn er ist kein „Schöpfergott außen“.
Eine wichtige Institution ist auch das gemeinsame Gebet in der Gruppe, in der Gemeinde, im Gottesdienst: Durch das kollektive Beten tritt alles Persönliche in den Hintergrund, und so fällt es ganz leicht, sich in diesem Größeren geborgen zu fühlen, der Gemeinschaft mit den anderen und der Gemeinschaft mit Gott.
Dieses unmittelbare, spirituelle Erleben ist die Gottesbeziehung. Wir können also „Gott im Herzen spüren“ als direkte Erfahrung, die jeden „Gottesbeweis“ überflüssig macht. So, wie wir auch nicht beweisen müssen, dass es Liebe gibt, oder Angst, oder Freude.
Die Evolution Gottes und des Satans
Wie kommt es, dass wir diesen Gott in uns haben? Dass wir so sind wie wir sind, verdanken wir der biologischen Evolution. Also sind wir wie alle anderen Arten auf Überleben getrimmt. Aber es geht nicht um das Überleben des Individuums, sondern um das Überleben der Spezies.
Die Spezies Homo sapiens zeichnet sich vor allen anderen durch die Sprache aus. Sprache ist eine Form der Informationsübertragung. Sie erlaubte den Menschen, intensiv zu kooperieren und als Gruppe zu handeln. Gemeinsam als Gruppe konnten sie in der Steinzeit den Säbelzahntiger erlegen, jeder einzelne wäre gefressen worden. Die Kooperation in der Gruppe ist also ein Überlebensfaktor, ein Selektionsvorteil.[36]
Dann hängt aber das Überleben des Individuums nicht nur ab von seinem eigenen Wohlergehen, sondern vom Wohlergehen aller Gruppenmitglieder. Wie schafft es also die Natur, dass ich nicht nur meine eigenen Interessen verfolge, sondern genauso auch die meines Mitmenschen im Blick habe, mich ihm zuwende, ihm helfe und für sein Wohlergehen sorge?
Sie gibt mir ein Gefühl der Freude, wenn ich ihm helfen konnte! Objektiv gesehen einen Opioid-Kick durch mein Belohnungszentrum. Dieser Mechanismus schenkt uns Menschen eine „Lust zum Guten“. Diese Lust kommt aus unserem Inneren, wir empfinden sie als göttliche Kraft, die Liebe zu Gott und zum Nächsten.[37] Klingt sehr banal, aber plausibel.
Doch die Kooperation in der Gruppe ist nicht der einzige Selektionsvorteil des Menschen. Angenommen in der Steinzeit geht es der ganzen Höhlengemeinschaft schlecht, sei es, dass sie hungert oder dass sie angegriffen wird. Dann hilft keine „Lust zum Guten“ mehr, dann ist Gewalt angesagt.
Dann vernichten wir mit Lust die Gruppe in der Nachbarhöhle, die uns die Resourcen wegnimmt, oder deren Resourcen wir haben wollen, um zu überleben. Dann setzen wir uns über alle altruistischen Empfindungen hinweg und haben einen ganz anderen Kick, eine „Lust zum Bösen“, die in Mordlust und sogar Blutrausch gipfelt. Das ist der Satan in uns, der uns zum Hass und in den Krieg treibt. Im Krieg ist das Töten legitim und gilt nicht als Mord. Vielleicht ist der Teufel ein aufgeblasenes Ego, das man braucht, um dreinzuschlagen. Ein Kick Testosteron sozusagen. Doch auch Gewalt und der Kampf haben die Evolution vorangetrieben: weil immer „die Fähigsten“ überlebten, wurden wir Menschen auf die Dauer immer „fähiger“.
Da sich unser Gehirn seit der Steinzeit nicht geändert hat, sind diese Antriebe zum Guten und zum Bösen auch heute noch genauso aktiv. Wie Luther im Disput mit Erasmus schrieb: „Der Mensch ist wie ein Reittier, er wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten.“[38] Doch haben diese Grunddispositionen im Verlauf der Entwicklung der Menschheit verschiedene kulturelle Ausprägungen erfahren, die jeweiligen Religionen.
Dass die Religionen in allen Kulturen vorkommen, zeigt, dass sich der autonome Antrieb „Gott innen“ spätestens mit der „Hominisation“ entwickelt haben muss, also mit der Entwicklung vom Affen zum Menschen. Schon die Schimpansen haben ja mindestens den Teufel, denn sie führen Vernichtungskriege gegeneinander.[39] Die DNA, die wir in uns tragen, „lebt“ also schon länger als 2 Millionen Jahre. In dieser Zeit hat sie eine optimale Überlebensstrategie erworben. Die ist jetzt tief in uns eingeprägt und gibt uns inneren Halt, den „Gott innen“. Aber eben auch der Teufel ist eingeprägt.
Schlussbetrachtung
Wenn wir so weit alles verstehen, können wir für uns selbst ruhig auch wieder die alte Sprache verwenden, denn wir wissen ja jetzt, wie sie gemeint war. Und wir können auch ruhig wieder die alten Vorstellungen verwenden, denn wir wissen jetzt, dass es keine Tatsachen sind, sondern Glaubensbilder. Also statt Bonhoeffers „etsi deus non daretur“[40] können wir uns sagen „etsi deus daretur“, also wir dürfen so tun als gäbe es diesen Gott außen, denn er ist außerhalb unseres Ich-Bewusstseins. Und wir dürfen uns vorstellen, dass er dort oben über den Wolken sitzt, auch wenn wir ja wissen, dass da nur der schwarze Weltraum beginnt, und sowieso die Erde eine Kugel ist, bei der es kein „oben“, sondern nur ein „außen“ gibt.
Und wir wissen uns täglich in Gottes Hand und danken ihm:
„dass Gott uns geschaffen hat samt allen Kreaturen, uns Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was not tut für Leib und Leben, uns reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt.“[41]
Und wir können sogar an Ostern die Auferstehung Jesu feiern, denn er ist wahrhaftig auferstanden – und zwar in uns – in Gestalt des Heiligen Geistes, wie den Jüngern dann im Pfingstereignis klar wurde. Dieser Geist erfüllt uns, und schenkt uns immer wieder einen Neuanfang.
Und auch wir selber werden nach unserem Tod zwar nicht physisch auferstehen, denn unser Gehirn ist unweigerlich zerstört. Aber in den Herzen unserer Mitmenschen, also, wie wir jetzt wissen, auch dort nahe bei Gott, wird unser Angedenken weiterleben.
Allgemeiner ausgedrückt existiert die Information weiter, die wir durch unser Dasein erzeugt haben. Diese Information wirkt weiterhin, verteilt sich und geht schließlich auf im allgemeinen Informationsgehalt des Lebens. Wir brauchen uns mit unserem Lebenswandel also kein Paradies zu verdienen, aber wir erkennen unsere Verantwortung für die kommenden Generationen und letztlich für die Menschheit insgesamt.
Doch müssen wir immer auch sehen, dass es dem Menschen nicht vergönnt ist, immer nur „gut“ zu sein. Sondern dass in manchen Notlagen auch Gewalt vonnöten ist, um selbst zu überleben, die „eigene Brut“ zu verteidigen und das eigene Land. Das Böse ist immer mit dabei. Selbst Jesus war vom Teufel geritten, als er die Geldwechsler mit Gewalt aus dem Tempel vertrieb.
Zuletzt muss ich aber betonen, dass dieser ganze Diskurs hier nur dazu dienen kann, Zweifler mit ihrem Glauben auszusöhnen. Er ist aber wohl keine Hilfe, um eine bewusste Gottesbeziehung zu begründen, denn das geht nicht durch vernünftige Überlegungen, sondern nur durch einen existenziellen Schritt, indem man sozusagen „sein eigenes Ich an Gott ausliefert“. Dafür helfen besser Jörg Zink oder Karl Rahner.
Schlussendlich sollte uns Christen bewusst sein, dass die anderen Religionen nur andere Sprachen sind. Nur die Worte sind verschieden, die inneren Empfindungen sind dieselben. Vielleicht kommt die Schnittmenge, also das Gemeinsame von allen, der Wahrheit am nächsten. Dann wäre das Ziel eine Art neuer Synkretismus, eine gemeinsamer Glauben für alle Menschen dieser Erde, damit wir uns alle gemeinsam als „Mitglieder unserer eigenen Gruppe“ begreifen und friedlich miteinander umgehen können, ohne unsere Steinzeit-Mentalität: „dies sind wir, die Guten“ – und „das sind die Anderen, die Schlechten und Bösen“. Dann könnten wir endlich alle gemeinsam für das Wohlergehen unserer Lebensgrundlage arbeiten, des Planeten Erde.
Schlussendlich können wir festhalten: Gott hat viele Namen, aber er existiert – nicht als ein übernatürliches Wesen, als Projektion „da außen“ – sondern dort, wo wir ihn spüren können, in unserem eigenen tiefsten Inneren. Auf C. G. Jungs Grabstein in Küsnacht steht:
„Vocatus atque non vocatus deus aderit“. (Ob uns bewusst ist oder nicht, Gott ist immer in uns.)
Prof. Dr. Helmut Kinder (Emeritus, Fakultät für Physik, Technische Universität München)
helmut.kinder@tum.de
Anmerkungen:
[1] „I need not believe, I know“, siehe https://www.youtube.com/watch?v=2AMu-G51yTY, 7’57”-8’03”
[2] R. Bultmann, Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden? (1925), in: ders., Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Band 1, Tübingen 1933, 26-37
[3] W. Härle, Dogmatik 4. Aufl., Seite 213 f.
[4] „Timeline of the Universe“, siehe http://www.dailyinfographic.com/extremely-detailed-history-of-the-universe?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+DailyInfographic+%28Daily+Infographic%29
[5] W. Härle, Dogmatik 4. Aufl., Seiten 449 – 467.
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace
[7] P. Jörns, Update für den Glauben, S. 100-103.
[8] Publik Forum Nr. 1, 2018, S. 26-30.
[9] P. Jörns, private Mitteilung.
[10] H. P. Dürr und M.Oesterreicher, Wir erleben mehr als wir begreifen, Herder 2005
[11] D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Hrsg. E. Bethge, Gütersloher Verlagshaus, 21. Aufl. 2013, Seite 163
[12] D.Bonhoeffer, Akt und Sein, München 1956, S.94.
[13] D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Hrsg. E. Bethge, Gütersloher Verlagshaus, 21. Aufl. 2013, Seite 192
[14] Lukas 17,20/21, so wörtlich übersetzt noch in der Lutherbibel von 1975; ab dann leider „mitten unter euch“, aber immer noch recht nah. Richtig wäre vielleicht: „gefühlt mitten unter euch“
[15] Martin Buber, Das dialogische Prinzip. Lambert Schneider, Heidelberg (1954)
[16] W. Härle, Dogmatik 4. Aufl. S. 67.
[17] Hanns Köbler, Ich möcht dass einer mit mir geht, Ev. Gesangbuch Lied 209.
[18] Dorothee Sölle, Atheistisch an Gott glauben, Walter Olten, 5. Aufl. 1979, S.83.
[19] Dorothee Sölle, Gegenwind; Erinnerungen, Hofmann & Campe, 1. Aufl. 1995, S. 62.
[20] Gerhard Roth, Fühlen Denken, Handeln, Neuaufl. 2003; Aus Sicht des Gehirns, Neuaufl. 2009
[21]Gerhard Roth, private Mitteilung auf der Tagung „Revolutioniert die Hirnforschung das Menschenbild?“ Hofgeismar, 20 .- 22. Oktober 2017
[22] https://de.wikipedia.org/wiki/Human_Brain_Project
[23] Benjamin Libet: Do we have a free will? In: Journal of Consciousness Studies, 5, 1999, S. 49; Haynes, J.D., Sakai, K., Rees, G., Gilbert, S., Frith, C. & Passingham, D. (2007). Reading hidden intentions in the human brain. Current Biology 17, 323-328.
[24] Sigmund Freud, Das Ich und das Es, 1923
[25] Carl Gustav Jung, Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion, Werke XI.
[26] Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube, 2. Aufl. 1830/31, Hrsg. v. Rolf Schäfer 2008, S. 32ff.
[27]Gerhard Roth, private Mitteilung auf der Tagung „Wie frei ist der menschliche Wille?“ Hofgeismar, 9 .- 10. Nov. 2019
[28] Exodus 20,4 (EU).
[29] Klaus Peter Jörns, Notwendige Abschiede, Gütersloher Verlagshaus 2004.
[30] Anselm von Canterbury, Proslogion cap. II.
[31] Andrew Newberg, , Why God Won't Go Away, Random House 2002.
[32] Wolf Singer, private Mitteilung.
[33] Aurelius Augustinus, Confessiones 1.1.
[34] Teresa von Avila, Die innere Burg, Hrsg v. Fritz Vogelsang, Diogenes 1979.
[35] Etty Hillesum, Das denkende Herz“, Rowohlt TB, 29. Aufl. 2019, S. 154
[36] Brian Hare, Survival of the Friendliest: Homo sapiens Evolved via Selection for Prosociality, Annual Review of Psychology, Vol. 68:155-186 (2017).
[37] Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst. EÜ16: Lukas 10,27
[38] Martin Luther, De servo arbitrio (Vom unfreienWillen), 1525.
[39] https://de.wikipedia.org/wiki/Schimpansenkrieg_von_Gombe
[40] D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Hrsg. E. Bethge, Gütersloher Verlagshaus, 21. Aufl. 2013, Seite 191.
[41] Martin Luther, Kleiner Katechismus.